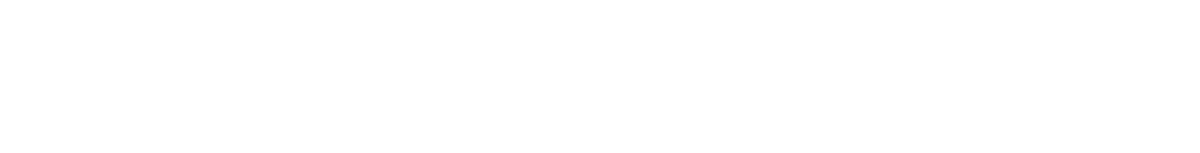Berichte
Alle untenstehenden Beiträge können Sie auch auf unserem Blog lesen:
sfb933.hypotheses.org.
Klicken Sie auf einen Titel, um sich den Beitrag anzeigen zu lassen.

Was uns Schrift im öffentlichen Raum über die Vergangenheit verrät – SFB-ler entwickeln neuen Stadtrundgang

Von Ute von Figura am 25. Mai 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3874
Ob Plakate, die mit schreienden Farben für Veranstaltungen werben, Schriftzüge in Schaufenstern, die zum Konsumieren einladen oder Schilder, die auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen – Schrift ist in den Innenstädten omnipräsent. Eine neue Tour, die über 19 Stationen durch die Heidelberger Altstadt führt, gibt Einblicke und Hintergründe zu historischen und zeitgenössischen Schriftzügen im Stadtbild. Entwickelt wurde der Stadtspaziergang „Schrift im öffentlichen Raum“ von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs (SFB) „Materiale Textkulturen“ der Universität Heidelberg. Einige der Stationen wurden dabei von Studierenden des Master-Studiengangs „Cultural Heritage … Was uns Schrift im öffentlichen Raum über die Vergangenheit verrät – SFB-ler entwickeln neuen Stadtrundgang weiterlesen
Abschlussausstellung eröffnet – Was Schrift und Material vormoderner Artefakte erzählen

Von Ute von Figura am 22. Mai 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3860
Mehr als 160 Forscherinnen und Forscher aus zahlreichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen der Universität Heidelberg und der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg haben in den vergangenen zwölf Jahren am SFB „Materiale Textkulturen“ Texte und Inschriften untersucht, die auf vormodernen Artefakten – also von Menschen geschaffenen Objekten – zu finden sind. Ende Juni 2023 wird der Forschungsverbund seine Arbeit beenden und lädt aus diesem Anlass zu der Abschlussausstellung „SchriftArteFakt“ ein. Die Ausstellung zeigt ausgewählte Objekte wie eine altägyptische Horus-Stele oder auch eine Alabasterscherbe aus der Zeit des … Abschlussausstellung eröffnet – Was Schrift und Material vormoderner Artefakte erzählen weiterlesen
The Cult of Relics

Von Ute von Figura am 18. April 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3811
von Silke Engelhardt Vom 23. bis 24. März 2023 fand der interdisziplinäre Workshop “The Cult of Relics in the Late Antique and Early Medieval Mediterranean” am Sonderforschungsbereich 933 “Materiale Textkulturen” statt. An zwei Tagen präsentierten und reflektierten die Teilnehmer:innen den Reliquienkult in der Spätantike und im frühmittelalterlichen Mittelmeerraum. Veranstaltet wurde der Workshop vom Teilprojekt A08 “Reliquienauthentiken” des SFB 933 sowie dem Netzwerk “The Cult of Relics in Late Antiquity”. Die Organisatorinnen waren Dr. Kirsten Wallenwein (SFB933), Dr. Nadine Viermann (University of Durham) und Katinka … The Cult of Relics weiterlesen
To make objects speak – Inscriptions as both things and texts

Von Ute von Figura am 28. Februar 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3765
by Anna Sitz After the Bronze Age collapse of circa 1200 BCE, Greeks forgot how to write. Linear B texts – syllabic script used for writing in Mycenaean Greek – disappeared. Greeks did not learn how to write again until perhaps the eighth century BCE, when, at various places in the Greek world, semitic letters were adopted and adapted to Greek language. The rest, as they say, is history: the Greeks developed or expanded many of the writing genres that are still with us … To make objects speak – Inscriptions as both things and texts weiterlesen
In Stein gemeisselt, aus Gold gesetzt – Schrift im Kirchenraum

Von Ute von Figura am 21. Februar 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3729
Ein Tagungsbericht von Solvejg Langer und Franziska Wenig Anfang Oktober 2022 fand am Sonderforschungsbereich 933 “Materiale Textkulturen” der Workshop “In Stein gemeißelt, aus Gold gesetzt. Schrift im Kirchenraum – Der lateinische Westen und griechische Osten im Vergleich” statt. In drei großen Sektionen („Bildung von Raum durch Schrift“, „Akteur:innen im sakralen Raum“ sowie „Bild und Schrift: Zusammenspiel zweier Medien“) gaben die Teilnehmer:innen an zwei Tagen Einblicke in ihre Forschung. Organisiert wurde das Treffen von den Doktorandinnen Solvejg Langer (Teilprojekt A01 UP4 „Epigramme in und an … In Stein gemeisselt, aus Gold gesetzt – Schrift im Kirchenraum weiterlesen
24 x #Vergängliche Schrift

Von Ute von Figura am 9. Januar 2023
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3620
“Vergängliche Schrift” lautete das Thema der Adventsaktion 2022 des SFB “Materiale Textkulturen”. Was macht Schrift vergänglich? Der Inhalt? Der Ort? Das Layout? Wo begegnet uns “vergängliche” Schrift? Kann ich selbst “vergängliche” Schrift verfassen? Die Mitglieder des SFB waren dazu aufgefordert, Fotografien oder kurze Filme ihrer “vergänglichen Schrift” einzusenden. Die Einreichungen wurden während des Advents nach und nach unter dem Hashtag #VergänglicheSchrift auf dem Twitter-Account des SFB veröffentlicht und erscheinen hier nun in einer Fotogalerie. Um die Bilder in vollständiger Größe als Galerie zu öffnen, … 24 x #Vergängliche Schrift weiterlesen
Sensible Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen

Von Ute von Figura am 15. Dezember 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3561
AUTORINNEN UND AUTOREN DER WIKIPEDIA ZU GAST IM MUSEUM SAMMLUNG PRINZHORN Mit dem Ziel, fundiertes Wissen über sensible Kunst – sogenannte Outsider Art oder auch Art brut – für eine breite Öffentlichkeit verfügbar zu machen, trafen sich am 19. November 2022 Wissenschaftler*innen und Wikipedianer*innen im Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Die ehrenamtlichen Autor*innen der Wikipedia informierten sich über Werke und Kunstschaffende der Sammlung und tauschten sich mit den Fachleuten aus. Zur direkten Umsetzung ging es bei einer Schreibwerkstatt am Nachmittag, in der neue Beiträge … Sensible Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen weiterlesen
Die Tontafel, die für einen Kaugummi gehalten wurde. Oder: Quittung über eine tote Ente

Von Ute von Figura am 8. Dezember 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3545
Von Emel Demirdizen Was haben wir hier vor uns: ein Kaugummi? Nein, es handelt sich um einen Notizzettel aus lang vergangenen Zeiten! In babylonischer Keilschrift steht in den Ton eingedrückt: „Eine tote Ente“. Was mag es mit dieser Botschaft auf sich haben? Emel Demirdizen, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt B01 „Materialisierung gedanklicher Ordnung. Darstellungsformen von Gelehrtenwissen auf Tontafeln“ des SFB „Materiale Textkulturen“, hat sich Gedanken zu dieser Frage gemacht und ein mögliches Szenario entworfen. Wir wissen nicht, wer oder was an diesem ereignisreichen Tag für … Die Tontafel, die für einen Kaugummi gehalten wurde. Oder: Quittung über eine tote Ente weiterlesen
Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt – Gewinnerinnen stehen fest

Von Ute von Figura am 1. Dezember 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3520
Die Gewinnerinnen des universitätsweiten Foto-Wettbewerbs „Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt“ stehen fest. Im Oktober hatte das Teilprojekt Ö „Schrifttragende Artefakte in Neuen Medien“ des SFB 933 „Materiale Textkulturen“ Angehörige der Universität mit einem Tattoo gesucht, das aus Schriftzeichen besteht oder Schriftzeichen enthält. Sie wurden aufgefordert, ein Foto ihres Tattoos einzureichen. Wir gratulieren der Gewinnerin Lilli Labroue, deren Tattoo-Foto nun Teil der SFB-Abschlussausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg wird. Die Ausstellung, die am 6. Mai 2023 eröffnet werden wird, präsentiert Fragestellungen und Ergebnisse des Forschungsverbundes anhand verschiedener … Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt – Gewinnerinnen stehen fest weiterlesen
Kooperation und Innovation im Speyerer Buchdruck – MTK-Band 37 erschienen

Von Ute von Figura am 1. Dezember 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3470
In der Reihe „Materiale Textkulturen“ (MTK) des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg ist der Band Nr. 37 mit dem Titel „Kooperation und Innovation im Speyerer Buchdruck des ausgehenden Mittelalters“ erschienen. Autor des 370 Seiten starken Werkes ist Paul Schweitzer-Martin, der von 2018 bis 2021 das Teilprojekt A06 „Die papierene Umwälzung im spätmittelalterlichen Europa. Vergleichende Untersuchungen zum Wandel von Technik und Kultur im ‘sozialen Raum’“ unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Schneidmüller unterstützte. Der Band ist auf den Webseiten des De Gruyter Verlags im … Kooperation und Innovation im Speyerer Buchdruck – MTK-Band 37 erschienen weiterlesen
Foto-Wettbewerb: Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt

Von Ute von Figura am 5. Oktober 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3444
Universitätsinterner Foto-Wettbewerb des Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“ Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt: Mit einem universitätsweiten Foto-Wettbewerb lädt der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ alle Mitglieder der Ruperto Carola ein, sich mit einem Beitrag an der SFB-Abschlussausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg zu beteiligen. Die Ausstellung präsentiert Fragestellungen und Ergebnisse des Forschungsverbundes mit verschiedenen schrifttragenden Objekten, darunter auch eine Tätowierung. Gesucht werden unter den Universitätsangehörigen Personen mit einem Tattoo, das aus Schriftzeichen besteht oder Schriftzeichen enthält. Sie sind eingeladen, ein Foto davon an den Sonderforschungsbereich zu senden. Unter allen Beiträgen … Foto-Wettbewerb: Das eigene Tattoo als Ausstellungsobjekt weiterlesen
Blinde Flecken füllen – Im Gespräch mit Valerie Garver

Von Ute von Figura am 21. Juni 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3364
Ein Proseminar über das Mittelalter war es, das den Ausschlag gab. Fasziniert von den Erzählungen über die „dunkle Epoche“ fragte die junge Studentin ihren Professor: „Was muss ich machen, um Ihren Beruf auszuüben?“. „Erst einmal Latein lernen“, lautete die Antwort. „Dann können Sie wiederkommen.“ Heute forscht und lehrt die US-Amerikanerin Valerie Garver an der Northern Illinois University zum Zeitalter des frühen Mittelalters und beschäftigt sich insbesondere mit Fragen zur Geschichte von Frauen, Geschlecht, Kindheit und Familie sowie mit der historischen und interdisziplinären Erforschung der … Blinde Flecken füllen – Im Gespräch mit Valerie Garver weiterlesen
Image, Text, Stone – 36. Band in MTK-Reihe Erschienen

Von Ute von Figura am 3. Mai 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3331
Mit der Intermedialität von Bild und Text in der griechisch-römischen Skulptur beschäftigt sich ein neuer Band, der in der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg erschienen ist. Herausgeber des englischsprachigen Sammelbandes mit dem Titel „Image, Text, Stone – Intermedial Perspectives on Graeco-Roman Sculpture“ sind Prof. Dr. Nikolaus Dietrich und Dr. Johannes Fouquet, die im Teilprojekt A10 „Schrift und Bild in der griechischen Plastik“ des SFB forschen. Ihre Arbeit schließt die traditionelle Kluft zwischen Archäologen, Epigraphikern und Philologen, die Statuen, materielle … Image, Text, Stone – 36. Band in MTK-Reihe Erschienen weiterlesen
The Materiality of Rulership and Administration

Von Ute von Figura am 25. April 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3300
A workshop report by Abby Armstrong At the end of March, subprojects B09 (Bamboo and Wood as Writing Materials in Early China) and B10 (Rolls for the King) welcomed researchers – albeit virtually – to a two-day workshop: Keeping Record: The Materiality of Rulership and Administration in the Pre-Modern World (24–25 March 2022). The workshop was the result of ongoing co-operation between the two subprojects and discussions that had stemmed from SFB 933’s Thematic Working Group 6: Rulership and Administration. With the focus on … The Materiality of Rulership and Administration weiterlesen
Muster Erkennen: Schrifttragende Artefakte aus Ägypten

Von Ute von Figura am 20. April 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3205
Ein Bericht von Anett Rózsa Die Frage nach Mustern in Layout und Layoutelementen schrifttragender Artefakte aus (dem Alten) Ägypten stand im Zentrum des interdisziplinären Workshops „Materiality, Layout and Formulas: Detecting Patterns in Written Artifacts from Egypt“, der vom 10. bis 12. März 2022 an der Universität Heidelberg stattfand. Organisiert wurde er von gleich drei Teilprojekten des Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“: dem Teilprojekt A03 „Materialität und Präsenz magischer Zeichen zwischen Antike und Mittelalter“, TP A09 „Schreiben auf Ostraka im inneren und äußeren Mittelmeerraum“ sowie TP … Muster Erkennen: Schrifttragende Artefakte aus Ägypten weiterlesen
Bild und Text auf römischen Mosaiken – 35. MTK-Band erschienen

Von Ute von Figura am 20. April 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3190
Mit der Kombination von Bild und Text in römischen Mosaiken beschäftigt sich ein neu erschienener Band der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg. Hierin legt die Autorin Claudia Schmieder eine umfassende medienwissenschaftliche Analyse der komplexen medialen Konfiguration dieser Kunstwerke vor. Der Band mit dem Titel „Bild und Text auf römischen Mosaiken – Intermediale Kommunikationsstrategien im Kontext der Wohnkultur des 3.–5. Jahrhunderts“ ist auf den Webseiten des De Gruyter Verlags im open access abrufbar. In der intensiven Nutzung der Kombination von … Bild und Text auf römischen Mosaiken – 35. MTK-Band erschienen weiterlesen
Dauerhafte Präsenz – Artefakte und ihre Künstlerinschriften

Von Ute von Figura am 1. April 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3136
Ein Tagungsbericht von Mandy Telle „Signaturentragende Artefakte. Schriften, Materialien, Praktiken im transkulturellen Vergleich“ lautete der Titel eines Kolloquiums, das am 11. und 12. März an der Universität Heidelberg stattfand. Im Zentrum der vom SFB 933 „Materiale Textkulturen“ organisierten Veranstaltung standen dabei Artefakte, die Künstlerinschriften tragen. Ziel war es, das Verhältnis von Material, Funktion und Gebrauch eines Artefakts zu der Schrift und die damit verbundene Präsenz seines Produzenten aus fächerübergreifender, transepochaler und gattungsübergreifender Perspektive zu erhellen. Signaturen sind Einschreibungen von Künstlerinnen und Künstlern in ihre … Dauerhafte Präsenz – Artefakte und ihre Künstlerinschriften weiterlesen
Von Weinflaschen, Songtiteln und Schrift – Doktorand:innenkolloquium 2022

Von Ute von Figura am 21. März 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3085
Ein Bericht von Hannah Mieger Promovieren ist immer mit Herausforderungen verbunden – Herausforderungen, denen man sich bewusst stellt, Herausforderungen aber auch, die unabsehbar sind und die alles verändern. Zu Beginn der letzten Förderperiode des Sonderforschungsbereichs 933 im Sommer 2019 konnte etwa niemand ahnen, dass die Welt bald unter einer Pandemie leiden würde. Um sich über die hieraus erwachsenen Schwierigkeiten auszutauschen und sich bei Unsicherheiten zu unterstützen, vor allem aber, um sich gegenseitig den aktuellen Stand der eigenen Forschung zu präsentieren und über die Arbeiten … Von Weinflaschen, Songtiteln und Schrift – Doktorand:innenkolloquium 2022 weiterlesen
Between Manuscript and Print – Transitions, Simultaneities and the Question of Shifting Meanings

Von Ute von Figura am 7. März 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3065
Ein Tagungsbericht von Paul Schweitzer-Martin Schrifttragende Artefakte non-typographischer Gesellschaften stehen im Zentrum der Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“. Insbesondere in der letzten Förderperiode werden kontrastierend aber auch Übergangsphänomene erforscht, um zu verstehen, wie und ob Möglichkeiten der Massenproduktion die Materialität von Texten beeinflussen. Ende Februar richtete der SFB hierzu eine internationale Tagung unter dem Titel „Between Manuscript and Print. Transitions, Simultaneities and the Question of Shifting Meanings“ aus. Im Zentrum der Tagung standen der Übergang von der Handschriften- zur Druckkultur sowie deren Gleichzeitigkeit vor allem … Between Manuscript and Print – Transitions, Simultaneities and the Question of Shifting Meanings weiterlesen
Coptic Magical Papyri on the Road: Letters, Archives and Communication in Late Antiquity
Von Ute von Figura am 17. Januar 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3037
A conference report by guest author Markéta Preininger Rodney Ast and Loreleï Vanderheyden of the SFB sub-project A02 “Antique Letters as a Means of Communication” organized a hybrid conference in Heidelberg on the 8th and 9th of November 2021 on the topic of letters, archives, and communication in Late Antiquity. As Rodney Ast remarked in his introduction to the conference, there has been an increasing focus in recent years on the appreciation of texts as physical products of communities organized around the cultures of writing. … Coptic Magical Papyri on the Road: Letters, Archives and Communication in Late Antiquity weiterlesen
Lesepraktiken im antiken Judentum – Neuer Band in MTK-Reihe erschienen

Von Ute von Figura am 14. Januar 2022
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3024
Unter dem Titel „Lesepraktiken im antiken Judentum – Rezeptionsakte, Materialität und Schriftgebrauch“ ist der 34. Band der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs 933 an der Universität Heidelberg erschienen. Der jüngste Band der Reihe bietet eine umfassende Geschichte des Lesens für das antike Judentum und schließt damit eine lang bestehende Forschungslücke. Anhand der Trias von Rezeptionsakten, Materialität und Schriftgebrauch zeichnet sein Autor Jonas Leipziger die Entwicklung von rituellen Lesepraktiken im antiken Judentum nach. Alle bisher erschienenen MTK-Bände sind auf den Webseiten des De Gruyter … Lesepraktiken im antiken Judentum – Neuer Band in MTK-Reihe erschienen weiterlesen
Text ohne Materie – Marina Garzón Fernández untersucht ‘inexistente’ Schriften

Von Ute von Figura am 17. Dezember 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3013
Im Zentrum des SFB 933 „Materiale Textkulturen“ stehen Fragen nach der spezifischen materialen Beschaffenheit des geschriebenen Textes. Was aber, wenn wir auf einen Text stoßen, der ohne Materie geschrieben ist? Ist das überhaupt möglich? Und kann man einen mit Luft geschriebenen Text lesen – einen Text, der Geist ist? „Ja“, verrät Marina Garzón Fernández, neues Mitglied im Teilprojekt C09 „Körperbeschriftungen: Text und Körper in den iberischen Literaturen der Vormoderne“ des SFB. Die Mediävistin muss es wissen: Schließlich stehen im Mittelpunkt ihrer Forschung genau solche … Text ohne Materie – Marina Garzón Fernández untersucht ‘inexistente’ Schriften weiterlesen
Handschrift im Druck. Annotieren, Korrigieren, Weiterschreiben (1500-1800)
Von Ute von Figura am 15. Dezember 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/3008
Ein Tagungsbericht von Rebecca Hirt & Paul Schweitzer-Martin Die Interaktion von handschriftlichen Eintragungen und gedrucktem Text stand im Mittelpunkt der Tagung „Handschrift im Druck. Annotieren, Korrigieren, Weiterschreiben (1500-1800)“, die Ende September am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ der Universität Heidelberg stattfand. Betrachtet wurden dabei Schriftstücke aus der Inkunabelzeit um 1500 bis hin zum Ende der ‚langen‘ Frühen Neuzeit um 1800. Ziel der Teilnehmenden war es, die semantischen Potentiale, die durch handschriftliche Eingriffe im gedruckten Text freigesetzt werden können, aus verschiedenen Perspektiven interdisziplinär zu beleuchten. Veranstaltet … Handschrift im Druck. Annotieren, Korrigieren, Weiterschreiben (1500-1800) weiterlesen
ERSTER KEMTE-BAND ERSCHIENEN

Von Ute von Figura am 8. Dezember 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2997
Mit Tradition und Traditionsverhalten in der Literaturwissenschaft beschäftigt sich der erste Band der neuen KEMTE-Reihe (Kulturelles Erbe: Materialität – Text – Edition), der nun erschienen ist. Die KEMTE-Reihe, die am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ und am Heidelberg Center for Cultural Heritage (HCCH) angesiedelt ist, dient der Veröffentlichung von Forschungsarbeiten zu Themen des kulturellen Erbes und seiner Materialität sowie von historisch-kritischen Editionen. Unter dem Titel „Tradition und Traditionsverhalten. Literaturwissenschaftliche Zugänge und kulturhistorische Perspektiven“ ist der erste Open-Access-Band der Reihe auf den Seiten des Heidelberger Universitätsverlages … ERSTER KEMTE-BAND ERSCHIENEN weiterlesen
Magische Papyri – Neues „3-Minuten-Wissenschaft“- Video

Von Ute von Figura am 29. November 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2992
„Steh auf für mich, katergesichtiger Gott, und fessle sie, behindere sie, so dass sie nicht mehr laufen können, fessle auch ihre Hände und lass ihre Tiere sterben.“ Mit derartigen Hymnen beschworen Menschen im Alten Ägypten den mächtigen Sonnengott, um ihren Gegnern oder Konkurrenten zu schaden. Komplizierte Handlungen vervollständigten das magische Ritual. Überliefert sind uns diese Praktiken auf handbeschriebenen Papyri, die aus dem 2. Jahrhundert vor bis ins 5. Jahrhundert nach Christus stammen. In der Video-Serie „3-Minuten-Wissenschaft“ führt die Ägyptologin Anett Rózsa in die Welt … Magische Papyri – Neues „3-Minuten-Wissenschaft“- Video weiterlesen
Bild & Schrift – Eine spannungsreiche Beziehung

Von Ute von Figura am 2. November 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2981
Neues „3-Minuten-Wissenschaft“-Video Wo Bilder und Schrift gemeinsam erscheinen, stehen sie in einer spannungsreichen Beziehung zueinander. Dass dabei der erste Eindruck täuschen kann, wie sich Schrift und Bild zueinander verhalten, zeigt Johannes Fouquet in der Serie „3-Minuten-Wissenschaft“ mithilfe moderner und antiker Beispiele. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt „Schrift und Bild in der griechischen Plastik“ des Heidelberger Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“ widmet er sich der Analyse von Schrift im und am Bild in der griechischen Plastik. Neugierig geworden? Dann klicken Sie hier. Video-Serie „3-Minuten-Wissenschaft“ Wie arbeiten Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler? Mit welchen Gegenständen … Bild & Schrift – Eine spannungsreiche Beziehung weiterlesen
Norm und Abweichung im frühen Buchdruck

Von Ute von Figura am 13. Oktober 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2966
Ein Workshop-Bericht von Paul Schweitzer-Martin An der Schwelle des Medienwechsels von handschriftlichen zu gedruckten Texten findet sich das Übergangsphänomen der Inkunabeldrucke: der ersten mit beweglichen Lettern erzeugten Druckwerke. Mit Normen und Abweichungen in diesen frühen Buchdrucken beschäftigte sich nun ein dreitägiger internationaler Workshop, der vom 29. September bis zum 1. Oktober 2021 an der Universität Heidelberg stattfand. Organisiert wurde er vom Teilprojekt A06 „Die papierene Umwälzung im spätmittelalterlichen Europa“ des Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“ gemeinsam mit Dr. Falk Eisermann und Dr. Oliver Duntze vom … Norm und Abweichung im frühen Buchdruck weiterlesen
Mittelalterliche Schätze digital präsentiert – „Corona als Chance“

Von Ute von Figura am 30. September 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2951
Drei Schätze der mittelalterlichen Altarkunst digital präsentiert – wer sich für den berühmten Genter, den Wildunger oder auch den Zwölf-Boten-Altar interessiert, findet auf der Webseite www.retabel-entdecken.de anschaulich aufbereitet Informationen zu Ikonographie, historischem Kontext, Herkunft und Technik. Studierende der Kunstgeschichte hatten die Online-Ausstellung vergangenes Sommersemester im Rahmen eines Proseminars entwickelt. Angeleitet wurden sie dabei von der Heidelberger Mediävistin Lisa Horstmann, die damit ein neues Format für die digitale Lehre erprobte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt A05 „Schrift und Schriftzeichen am und im mittelalterlichen Kunstwerk“ … Mittelalterliche Schätze digital präsentiert – „Corona als Chance“ weiterlesen
Streit um die Krone – Reingehört mit Matthias Kuhn

Von Ute von Figura am 22. Juli 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2929
In seinem Podcast „Rosenkriege“ entführt uns Matthias Kuhn in die Welt der verworrenen englischen Beziehungsfehden zu Zeiten Richard des Dritten. Strategische Vermählungen sollten den Weg zum Thron Englands ebnen. Der Historiker erzählt von einer Familie, die die wechselhafte Geschichte der Rosenkriege im 15. Jahrhundert zunächst mitbestimmte und schließlich an der Nähe zu Macht und Herrschaft zugrunde ging. Es handelt sich um die Schicksale des Kingmakers Richard Neville, seiner Frau Anne Beauchamp und ihrer Nachkommen. Innerhalb von nur 30 Jahren wendete sich das Blatt für … Streit um die Krone – Reingehört mit Matthias Kuhn weiterlesen
Shedding light on Sanctuaries as spaces for political actions

Von Ute von Figura am 14. Juli 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2918
A conference report by Sarah Herzog & Wang Banban The international workshop “Sanctuaries as spaces for political actions: approaching the sacred in Greek poleis”, hosted by the Collaborative Research Centre “Material Text Cultures” from 24 to 26 June 2021, dealt with Greek sanctuaries and different types of political actions taking place within these sacred spaces. Ten speakers from six countries gave talks, ranging from thirty to forty-five minutes, covering periods from the Archaic time to Roman Greek East, examining sources including literary texts, epigraphy, … Shedding light on Sanctuaries as spaces for political actions weiterlesen
Typographische Visualisierung von Forschungsaspekten – Kooperation mit Typo-Passage

Von Ute von Figura am 7. Juli 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2899
Die Kooperation des Heidelberger Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“ mit der „Typo-Passage: Mikromuseum für Gestaltung von und mit Schrift“ aus Wien geht in die zweite Runde: Nachdem von April bis Juni eine Plakatserie gezeigt wurde, die sich mit der Inschrift auf einer griechischen Plastik auseinandersetzte, nimmt die typographische Gestaltung der nun ausgestellten Poster Bezug auf eine ägyptische Gemme. Von Ende Juni bis September 2021 ist die aktuelle Ausstellung in der Typo-Passage im Wiener Museumsquartier zu sehen. Indem die Poster-Serie historische und zeitgenössische Typographie nebeneinanderstellt, wird … Typographische Visualisierung von Forschungsaspekten – Kooperation mit Typo-Passage weiterlesen
Passionierte Radfahrerin und Archäologin – ZDF-Feature über Polly Lohmann

Von Ute von Figura am 25. Juni 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2890
„Per Rad in die Römerzeit“ – unter diesem Titel hat das ZDF in seiner Sendereihe „sonntags“ ein Feature über Polly Lohmann gezeigt. Die 34-jährige Archäologin ist Kuratorin der Antikensammlung der Universität Heidelberg und Mitglied des Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“. 2017 war sie mit dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts von Frankreich über Spanien, Marokko bis nach Tunesien geradelt, um antike Stätten zu besichtigen. Das Feature, das am 13. Juni online ging, ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Gleich für zwei Beiträge wurde das Interview, das ZDF-Moderator … Passionierte Radfahrerin und Archäologin – ZDF-Feature über Polly Lohmann weiterlesen
Mit tradierten Vorstellungen aufräumen – Im Gespräch mit Babett Edelmann-Singer

Von Ute von Figura am 15. Juni 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2869
„Das klingt aber seltsam“ – wenn Babett Edelmann-Singer über etwas stolpert, das ihr nicht schlüssig erscheint, springt ihre forscherische Neugierde an. Dann versucht sie, den Nebel zu lichten, der sich im Laufe der Jahrtausende über die Antike gelegt hat. Dabei nähert sie sich der vorchristlichen Wirklichkeit durch die Erforschung damaliger Objekte an. Denn Objekte sind mitnichten bloße Symbole menschlichen Handelns, wie sie erklärt. Vielmehr entfalten die Artefakte durch ihre besondere Beziehung zu Mensch und Umwelt eine eigene Wirkung und Sprache, die ihnen die Althistorikerin … Mit tradierten Vorstellungen aufräumen – Im Gespräch mit Babett Edelmann-Singer weiterlesen
„Keiner kann sich der Wirkung von Typographie entziehen“ – Kooperation des SFB mit der Typo-Passage in Wien

Von Ute von Figura am 31. Mai 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2837
Für eine ungewöhnliche Kooperation haben sich im vergangenen Jahr der Heidelberger Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ und die „Typo-Passage: Mikromuseum für Gestaltung von und mit Schrift“ aus Wien zusammengetan: Die moderne Visualisierung von Forschungsaspekten mithilfe typographischer Mittel. Das erste Ergebnis in Form einer fünfteiligen Plakatserie ist nun in der Wiener Typo-Passage im MuseumsQuartier Wien / Q21 zu sehen. Die Wahl der typographischen Mittel ist stets abhängig von Material, Werkzeug, Zielgruppe, handwerklichen Fähigkeiten und ästhetischem Empfinden. Der Sonderforschungsbereich 933 macht sich diesen Sachverhalt bei der Analyse … „Keiner kann sich der Wirkung von Typographie entziehen“ – Kooperation des SFB mit der Typo-Passage in Wien weiterlesen
Gemeinsam statt einsam – 1. Doktorand*innen-kolloquium des SFB 933

Von Ute von Figura am 7. April 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2804
Ein Bericht von Hannah Mieger Die Pandemie hat auch uns Promovierende fest im Griff. Neben den allgemeinen Belastungen und Sorgen, von denen wir alle seit nunmehr über einem Jahr in mehr oder weniger starkem Maß betroffen sind, wird unsere Forschung nahezu ausgebremst: Bibliotheken und Archive waren und sind nur eingeschränkt zugänglich, dringend notwendige Forschungsreisen müssen bis auf Weiteres verschoben werden, Tagungen und Konferenzen wurden teilweise in den digitalen Raum verlegt, die Bildschirmzeit wächst ins Unermessliche und der Elfenbeinturm der eigenen Forschung scheint jeglicher Austauschmöglichkeit … Gemeinsam statt einsam – 1. Doktorand*innen-kolloquium des SFB 933 weiterlesen
Das Mysterium Vergangenheit – Im Gespräch mit Sebastian Watta

Von Ute von Figura am 29. März 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2791
Schon mit 12 Jahren schaute sich Sebastian Watta auf eigene Faust Kirchen und Klöster an. Und während andere am Nachmittag in Sportverein oder Chor gingen, büffelte Sebastian als Teenager aus eigenem Antrieb fürs Graecum. Nach dem Studium der Christlichen Archäologie, Kunstgeschichte und Theologie erforscht der 41-Jährige heute sakrale Bauten der Spätantike. Im Zentrum stehen dabei Inschriften und die Frage, welche Wirkungen diese bei Zeitgenossen und Nachwelt entfalteten. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ arbeitet Sebastian Watta seit Anfang dieses Jahres als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt … Das Mysterium Vergangenheit – Im Gespräch mit Sebastian Watta weiterlesen
Die Stadt als beschriebener Raum – Neuer Band in MTK-Reihe erschienen

Von Ute von Figura am 10. März 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2783
Mit Inschriften im öffentlichen Raum der römischen Städte Pompeji und Herculaneum beschäftigt sich ein neu erschienener Band der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg. Unter dem Titel „Die Stadt als beschriebener Raum – Die Beispiele Pompeji und Herculaneum“ widmet sich die Autorin Fanny Opdenhoff insbesondere der Frage, wie Inschriften in damalige Praktiken sowie den architektonischen und urbanen Befund des öffentlichen Raumes eingebettet waren, um sie so als zeit- und raumspezifische Artefakte verständlich zu machen. Alle bisher erschienenen MTK-Bände sind auf … Die Stadt als beschriebener Raum – Neuer Band in MTK-Reihe erschienen weiterlesen
Grenzen in vormodernen Texten

Von Ute von Figura am 14. Januar 2021
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2774
Ein Tagungsbericht von Ben Kraemer Mit sichtbaren und unsichtbaren Textgrenzen beschäftigte sich der interdisziplinäre Workshop „Grenzen in vormodernen Texten“, zu dem der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ in Kooperation mit dem Graduiertenkolleg „Dokument – Text – Edition“ der Bergischen Universität Wuppertal am 12. November 2020 eingeladen hatte. Zu den Vortragenden zählten Mitglieder beider Forschungsverbünde, die in virtueller Runde ihre laufenden Forschungsprojekte präsentierten. Dabei nahmen sie sowohl handschriftliche als auch gedruckte Texte von der Spätantike bis in die frühe Neuzeit in den Blick und zeigten, wie vielfältig … Grenzen in vormodernen Texten weiterlesen
Fotokampagne #Schrift im Alltag

Von Ute von Figura am 26. Dezember 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2700
“Schrift im Alltag” stand im Mittelpunkt der diesjährigen Adventsaktion des SFB “Materiale Textkulturen”. Alle Mitglieder des SFB waren dazu aufgefordert, Fotografien von Geschriebenem einzureichen, das ihnen im Alltag begegnet war – sei es als Graffiti an Hauswänden, als Gekritzel in Büchern oder auch auf Stickern an Straßenlaternen. Die 28 Einreichungen wurden während des Advents nach und nach unter dem Hashtag #SchriftImAlltag auf dem Twitter-Account des SFB veröffentlicht und erscheinen nun hier in einer Fotogalerie. Um die Bilder in vollständiger Größe als Galerie zu öffnen, … Fotokampagne #Schrift im Alltag weiterlesen
Black Boxes und Ostraka – Zwei neue Bände in MTK-Reihe erschienen

Von Ute von Figura am 10. Dezember 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2688
In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg sind zwei neue Bände erschienen. Band Nr. 31 mit dem Titel „Black Boxes – Versiegelungskontexte und Öffnungsversuche“ vereint dreizehn Beiträge verschiedener Autoren, die sich dem Phänomen der Black Boxes widmen – komplexer Dinge, die gleichzeitig wirken und doch hinter Interfaces verborgen sind. Der englischsprachige Band „Using Ostraca in the Ancient World“ (Band Nr. 32 der MTK-Reihe) beschäftigt sich mit beschrifteten Ton- und Kalksteinscherben, sogenannten Ostraka. Auf 252 Seiten werden verschiedene Methoden beleuchtet, … Black Boxes und Ostraka – Zwei neue Bände in MTK-Reihe erschienen weiterlesen
Transatlantische Kooperation zur „Anthologia Palatina“

Von Ute von Figura am 1. Dezember 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2675
Mit 3.765 Epigrammen auf 614 Seiten ist sie die umfassendste Sammlung ihrer Art und damit von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft: die Anthologia Palatina. Sicher in einem Tresor in der Universitätsbibliothek Heidelberg verwahrt, gewährt uns die kostbare Handschrift Einblick in die griechische Literaturgeschichte von ihren archaischen Anfängen im 6. Jahrhundert v. Chr. bis in das byzantinische 10. Jahrhundert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFB 933 „Materiale Textkulturen“ arbeiten an einer digitalen Teiledition des Werkes, die nicht nur Transkriptionen und Übersetzungen, sondern zusätzliche Hintergrundinformationen wie archäologische … Transatlantische Kooperation zur „Anthologia Palatina“ weiterlesen
Die Geschichte mit Leben füllen – Im Gespräch mit Saskia Limbach

Von Ute von Figura am 17. November 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2656
Einzelne Entwicklungsstränge miteinander zu verknüpfen und so einen Überblick über die großen Zusammenhänge zu bekommen – das ist es, was die Historikerin Saskia Limbach an ihrer Arbeit fasziniert. Mithilfe sorgfältiger Recherche und eines gründlichen Quellenstudiums taucht sie in die Epoche der frühen Neuzeit ein und füllt sie mit Leben. Insbesondere interessiert sie sich dabei für das 16. Jahrhundert und die Welt der ersten Druckereien sowie ihrer Protagonisten. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ arbeitet Saskia Limbach seit Ende September dieses Jahres als Mercator-Fellow in den … Die Geschichte mit Leben füllen – Im Gespräch mit Saskia Limbach weiterlesen
Ruf an die Universität Osnabrück – Dr. Stefan Ardeleanu übernimmt Professur „Archäologie der römischen Provinzen“

Von Ute von Figura am 9. November 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2645
Dr. Stefan Ardeleanu ist zum 1. November auf die Juniorprofessur „Archäologie der römischen Provinzen“ am Historischen Seminar der Universität Osnabrück berufen worden und verlässt damit nach vier Jahren den Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“. Hier hatte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt A01 UP2 zuletzt zu spätantiken Grabinschriften und Grabriten in den Nordwestprovinzen des Römischen Reiches geforscht. An der Universität Osnabrück übernimmt Stefan Ardeleanu neben der Juniorprofessur die wissenschaftliche Leitung der Grabungen in Kalkriese, dem vermutlichen Ort der Varusschlacht. Die Stiftungsprofessur wird von der Varus-Gesellschaft … Ruf an die Universität Osnabrück – Dr. Stefan Ardeleanu übernimmt Professur „Archäologie der römischen Provinzen“ weiterlesen
Blick über den Tellerrand – Ungewohnte Annäherung an historische Artefakte

Von Ute von Figura am 6. November 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2634
Der Mut für Gedankenexperimente und die Neugierde, sich dem eigenen Forschungsgegenstand einmal aus anderer Perspektive zu nähern, standen im Zentrum des zweitägigen Workshops zu den Themen „User Experience“ und „Visual Perception“, der Ende Oktober am SFB 933 „Materiale Textkulturen“ stattfand. Das Teilprojekt Ö „Schrifttragende Artefakte in Neuen Medien“ hatte hierzu als Referent*innen die Mediendesignerin und User-Experience-Expertin Melanie Wetter sowie Axel Buether, Professor für Didaktik der Visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal, eingeladen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten einen Blick über den Tellerrand ihrer … Blick über den Tellerrand – Ungewohnte Annäherung an historische Artefakte weiterlesen
Wie wir den Codex Manesse nach Mainz verfolgten…

Von Ute von Figura am 14. Oktober 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2614
Ein Exkursionsbericht von Hannah Mieger Normalerweise wird er in einem klimatisierten Tresor verwahrt und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich: Der Codex Manesse – die umfangreichste Sammlung mittelhochdeutscher Lied- und Spruchdichtung und der wohl wertvollste Schatz der Heidelberger Universitätsbibliothek. Aktuell wird die Handschrift in der Mainzer Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ gezeigt. Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des SFB „Materiale Textkulturen“ wollte sich die Chance nicht entgehen lassen, den Codex im Original zu sehen. Doktorandin Hannah Mieger berichtet von ihrer Exkursion … Wie wir den Codex Manesse nach Mainz verfolgten… weiterlesen
Auseinandersetzung mit dem Original – Kunsthistorikerin Rebecca Müller im Gespräch

Von Ute von Figura am 10. September 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2597
„Die Kunstgeschichte hat ihren Sitz im Leben.“ Rebecca Müller forscht zur Antikenrezeption im Mittelalter und ist fasziniert von den Querverbindungen und Parallelen, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichen. Im vergangenen Jahr nahm sie einen Ruf an das Institut für Kunstgeschichte der Universität Heidelberg an. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ leitet sie das im Juni dieses Jahres neu hinzugekommene Teilprojekt A12 „Präsenz des Künstlers. Mittelalterliche Artefakte mit Künstlerinschriften“. Ute von Figura: Ihre wissenschaftliche Laufbahn hat mit dem Studium der Fächer Kunstgeschichte, Klassische … Auseinandersetzung mit dem Original – Kunsthistorikerin Rebecca Müller im Gespräch weiterlesen
Fundamentaler Wandel – Massenkommunikation als Motor einer neuen Zeit

Von Ute von Figura am 4. August 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2580
„Die Druckerpressen veränderten im ausgehenden 15. Jahrhundert Kultur und Gesellschaft und brachten eine ‚Kommunikationsrevolution‘ als wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung von Humanismus oder Reformation.“ Mit medialen Wandlungsprozessen im Spätmittelalter und ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigen sich die SFB-Wissenschaftler Prof. Dr. Bernd Schneidmüller und Paul Schweitzer-Martin. Die bisherigen Ergebnisse des Projekts haben sie nun in einem Artikel mit dem Titel „Fundamentaler Wandel – Massenkommunikation als Motor einer neuen Zeit“ veröffentlicht. Dieser ist in der neuen Ausgabe des Forschungsmagazins „Ruperto Carola“ der Universität Heidelberg … Fundamentaler Wandel – Massenkommunikation als Motor einer neuen Zeit weiterlesen
Geburtshelferin digitaler Publikationsformate – Maria Effinger bringt Texten das Sprechen bei

Von Ute von Figura am 22. Juli 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2540
„So wie ein Kind regelmäßig mit einer neuen Garderobe ausgestattet werden muss, so muss auch das ‚Gewand‘ einer digitalen Publikation alle paar Jahre überarbeitet werden“. Maria Effinger, Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek Heidelberg, kennt sich bestens mit den Anforderungen moderner Publikationsformate aus. Mit großem Engagement unterstützt sie Forschende dabei, ihre über lange Jahre erarbeiteten Ergebnisse in digitaler Form zu veröffentlichen und dabei zum Sprechen zu bringen. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ der Universität leitet sie ein im vergangenen Jahr neu hinzugekommenes Serviceprojekt, das Text- und … Geburtshelferin digitaler Publikationsformate – Maria Effinger bringt Texten das Sprechen bei weiterlesen
Faszination Japan – Melanie Trede im Podcast
Von Ute von Figura am 8. Juli 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2524
In der Podcast-Serie „Auf ein Akademisches Viertel …“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist ein Gespräch mit der Kunsthistorikerin und Japanologin Melanie Trede erschienen. Die SFB-Wissenschaftlerin spricht in dem Podcast über ihre aktuellen Arbeiten an japanischen Querrollen, den Forschungsalltag in Zeiten von Corona und darüber, wie eng Natur, Kunst und Kultur in Japan miteinander verwoben sind. Melanie Trede ist Professorin am Institut für Kunstgeschichte Ostasiens in Heidelberg. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ der Universität leitet sie das Teilprojekt B14 „Interaktive Medien: Interdependenzen zwischen Geschriebenem/Gemaltem … Faszination Japan – Melanie Trede im Podcast weiterlesen
Rohstoff Papier – Geschäftsstelle zeigt Stiche zur Papierherstellung

Von Ute von Figura am 30. Juni 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2496
Vom mühsamen Zerreißen der Lumpen über das Schöpfen an der Bütte bis hin zum Pressen und Trocknen der Papiere – die Geschäftsstelle des Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“ zeigt auf großformatigen Stichen den Alltag eines Papiermachers im Mittelalter. Billiger als der traditionelle Beschreibstoff Pergament und massenhaft herstellbar löste Papier vor über 600 Jahren eine mediale Revolution aus. Ausgangsmaterial für die Papierherstellung im Mittelalter waren Stofflumpen: schimmlige Fetzen, verdreckte Lappen oder auch blutige Verbände. Diese in kleine Stücke zu zerlegen war Aufgabe der Lumpenreißerinnen – eine … Rohstoff Papier – Geschäftsstelle zeigt Stiche zur Papierherstellung weiterlesen
Bewegte Epoche – Corinna Bottiglieri forscht zu mittelalterlichen Texten

Von Ute von Figura am 26. Mai 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2475
„Es ist überaus faszinierend, die Geschichte von Texten zu rekonstruieren: unter welchen Umständen sie entstanden sind, was ihre Inhalte über das Selbstverständnis des Autors und der Epoche aussagen oder auch welche Bezüge beispielsweise zwischen mittelalterlichen und klassischen Autoren bestehen.“ Im Sommersemester 2020 forscht Corinna Bottiglieri als Gastprofessorin am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“. Ihr Steckenpferd sind lateinische Dichtungen des Früh- und Hochmittelalters. Ute von Figura: Corinna, du bist seit April hier am SFB. Wie kam es dazu? Corinna Bottiglieri: Die Anfrage, Professor Licht in seinem … Bewegte Epoche – Corinna Bottiglieri forscht zu mittelalterlichen Texten weiterlesen
Material Aspects of Reading in Ancient and Medieval Cultures – Neuer MTK-Band erschienen

Von Ute von Figura am 23. April 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2456
In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg ist der Band 26 „Material Aspects of Reading in Ancient and Medieval Cultures“ erschienen. Auf 265 Seiten widmet sich der englischsprachige Sammelband anhand von Fallstudien den Rezeptionspraktiken in antiken und mittelalterlichen Kulturen. Herausgeber sind die ehemaligen SFB-WissenschaftlerInnen Anna Krauß und Friederike Schücking-Jungblut (Teilprojekt C02 UP2 „Zwischen Literatur und Liturgie – Pragmatik und Rezeptionspraxis poetischer/liturgischer Schriften der judäischen Wüste“) sowie Jonas Leipziger (ehemals Teilprojekt B04 „Der Masoretische Text der Hebräischen Bibel in seinen … Material Aspects of Reading in Ancient and Medieval Cultures – Neuer MTK-Band erschienen weiterlesen
Auf der Spur der Alten Ägypter – Carina Kühne-Wespi entziffert Schriften aus der Zeit der Pharaonen

Von Ute von Figura am 6. April 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2424
Was als kindliche Begeisterung begann, ist heute Grundstein einer erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere. Einst tauschte Carina Kühne-Wespi mit ihrer Schulfreundin geheime Botschaften in Hieroglyphenschrift aus, heute beschäftigt sich die gebürtige Schweizerin tagtäglich mit dem Studium der kunstvollen altägyptischen Schriftzeichen. Am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ der Universität Heidelberg leitet sie seit Anfang April 2020 das neue Teilprojekt B15 „Visuelle Gliederungsmittel ägyptischer Texte auf Papyrus“. Ute von Figura: 2009 hast du mit deinem Studium der Ägyptologie begonnen. Nach dem Bachelor folgte der Master, dann die Promotion. Neuerdings … Auf der Spur der Alten Ägypter – Carina Kühne-Wespi entziffert Schriften aus der Zeit der Pharaonen weiterlesen
Wenn Texte Blüten tragen – Oder: Die Lust am Überraschungsmoment

Von Ute von Figura am 28. Februar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2045
Der Text ist ein vielschichtiges Blätterteiggebäck; diese Metapher des französischen Philosophen und Schriftstellers Roland Barthes könnte auch von der Germanistin Beatrice Trînca stammen. Satz für Satz, Wort für Wort, Zeichen für Zeichen entblättert sie die Bedeutung mittelalterlicher Manuskripte. Spannend wird es für sie da, wo eine Schrift nicht auf Anhieb zu bisherigen Erkenntnissen passt und verschiedene Deutungsmuster zulässt. Seit Beginn des Wintersemesters 2019/20 forscht die 40-Jährige als Gastprofessorin am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“. Ute von Figura: Beatrice, du bist seit Oktober 2019 hier am … Wenn Texte Blüten tragen – Oder: Die Lust am Überraschungsmoment weiterlesen
At the Mercy of History – Winner of the SFB-Story Contest

Von Ute von Figura am 12. Februar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2260
by Giuditta Mirizio (TP A03 UP2 “Materiality and Presence of Magical Signs between Antiquity and the Middle Ages – Prayers for Justice to Gods and Demons”) I made it! A small, insignificant lead tablet made its way into history. I thought I would have never come to light again! I was cut, inscribed, turned upside down, exposed to public view, reused, folded and then deposited on the occasion of a ritual in a sanctuary. I do not know who precisely scratched the text on … At the Mercy of History – Winner of the SFB-Story Contest weiterlesen
‘Fix, Schwyz!’ quäkt Jürgen blöd vom Paß – 2nd prize in the SFB-story contest

Von Ute von Figura am 5. Februar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/2175
by Julia Lougovaya-Ast (TP A09 “Writing on Ostraca in the Inner and Outer Mediterranean“) A couple of years ago a tiny sherd found on the outskirts of Montpellier in Southern France caught my attention because it was inscribed with the first four letters of a Greek pangram that had been known from papyri and ostraca in Egypt, κναξζβιχθυπτησφλεγμοδρωψ. Pangrams are words or sentences that contain all letters of a given alphabet; a perfect pangram, like the one on the sherd, has each letter only … ‘Fix, Schwyz!’ quäkt Jürgen blöd vom Paß – 2nd prize in the SFB-story contest weiterlesen
Was Herrscher früher schreiben ließen und Vögel heute zwitschern – 3. Preis im Story-Wettbewerb

Von Ute von Figura am 29. Januar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1995
von Hannah Mieger (TP C10 “Briefe als materiale Kommunikation in der Literatur des 12. bis 17. Jahrhunderts“) „Und was bringt deine Forschung?“ Wer frisch examiniert direkt eine Doktorandenstelle antritt, umgeht zwar die Frage von Freunden und Verwandten nach der beruflichen Zukunft, doch muss sich stattdessen den neugierigen bis polemischen Fragen zum Forschungsgegenstand stellen. Das Thema „Briefe als materiale Kommunikation in der Literatur des 12. bis 17. Jahrhunderts“ erzeugt bei Nicht-Mediävisten nicht gerade unbändige Begeisterung und wirft häufig die Frage auf, warum man sich denn … Was Herrscher früher schreiben ließen und Vögel heute zwitschern – 3. Preis im Story-Wettbewerb weiterlesen
Das wütende Radieschen – 3. Preis im Story-Wettbewerb

Von Ute von Figura am 22. Januar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1895
von Lisa Horstmann (TP A05 “Schrift und Schriftzeichen am und im mittelalterlichen Kunstwerk“) Bilder treffen uns direkt und bewegen etwas in uns, noch bevor wir sie bewusst wahrnehmen. So auch das ›wütende Radieschen‹, das ich in der Kölner Schatzkammer angetroffen habe. In einem abgedunkelten Raum, in den Gemäuern tief unter dem Kölner Dom werden die Schätze der christlichen Kunst aus dem 4. bis zum 20. Jahrhundert ausgestellt. Umgeben von feinsten Schmiedearbeiten in Gold und Silber, prunkvollen Gewändern und luxuriösen liturgischen Utensilien stehen an einer … Das wütende Radieschen – 3. Preis im Story-Wettbewerb weiterlesen
DIE WILDNIS IN UND ZWISCHEN UNS – INZEST IN DER LITERATUR DES MITTELALTERS

Von Ute von Figura am 15. Januar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1875
„Das Erzählen vom Inzest wird in der mittelalterlichen Legendarik auch eine Auseinandersetzung mit der Sünde, die einem schon in die Wiege gelegt ist: Die Erbsünde.“ Sarina Tschachtli, Wissenschaftlerin am Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“, setzt sich im Rahmen ihres Habilitationsprojektes mit mittelalterlichen Erzählungen über Inzest auseinander. Nun ist ihr Artikel „Die Wildnis in und zwischen uns – Inzest in der Literatur des Mittelalters“ in der neuen Ausgabe des Forschungsmagazins „Ruperto Carola“ der Universität Heidelberg erschienen. Inzest ist im Mittelalter nicht nur Gegenstand theologischer Traktate und … DIE WILDNIS IN UND ZWISCHEN UNS – INZEST IN DER LITERATUR DES MITTELALTERS weiterlesen
GESTANK DER GESCHICHTE – ZU BESUCH IN DER PAPIERMÜHLE BASEL

Von Ute von Figura am 8. Januar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1683
„Geschichte erfahrbar machen durch Hand anlegen“ – das ist das Motto des Museums Basler Papiermühle. Über vier Stockwerke führt das Museum in die Geschichte des Papiers, der Schrift und des Schreibens ein und zeigt alte, teils ausgestorbene Handwerkstechniken, die selbst ausprobiert werden können. Dass es allerdings nicht immer angenehm ist, wenn Geschichte zum Leben erweckt wird, durften die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer vom Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ organisierten Exkursion erfahren. Anfang Dezember hatten sie sich für zwei Tage auf den Weg zur Papiermühle … GESTANK DER GESCHICHTE – ZU BESUCH IN DER PAPIERMÜHLE BASEL weiterlesen
The Roll in England and France in the Late Middle Ages – Neuer MTK-Band erschienen

Von Ute von Figura am 7. Januar 2020
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1665
In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg ist der Band 28 „The Roll in England and France in the Late Middle Ages“ erschienen. Herausgeber des 325-Seiten starken Sammelbands sind die SFB-Wissenschaftler Stefan Holz, Prof. Dr. Jörg Peltzer und Maree Shirota (Teilprojekt B10 „Rollen im Dienst des Königs. Das Format der Rolle in Königlicher Verwaltung und Historiographie im spätmittelalterlichen Westeuropa“). ZU DEN INHALTEN DES BANDES In the Middle Ages, rolls were ubiquitous as a writing support. While scholars have long … The Roll in England and France in the Late Middle Ages – Neuer MTK-Band erschienen weiterlesen
Verrätselung von Geschriebenem

Von Ute von Figura am 19. Dezember 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1631
Ein Bericht von Anett Rózsa „As we can scarcely imagine a time when there did not exist a necessity, or at least a desire, of transmitting information from one individual to another, in such manner as to elude general comprehension; so we may well suppose the practice of writing in cipher to be of great antiquity.“ Edgar Allan Poe Die Präsenz von Schrift ist zumeist mit dem Bestreben verbunden, Mitteilungen zu machen und zu kommunizieren. Es gibt aber auch Fälle, in denen dem Leser … Verrätselung von Geschriebenem weiterlesen
Was Mumien mit Papyri zu tun haben – Der SFB zu Besuch in Köln

Von Ute von Figura am 13. Dezember 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1607
Ein Bericht von Paul Schweitzer-Martin und Giuditta Mirizio Anlässlich des Beginns der dritten Förderphase fuhr eine Gruppe des Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“ vom 5. bis 7. Dezember 2019 nach Köln. Im Zentrum der Exkursion standen Besuche der Papyrologischen Sammlung der Universität zu Köln sowie des Doms und seiner Schatzkammer, die mit manch spannender Erkenntnis aufwarteten. Zusätzlich diente die Fahrt der Vernetzung unter den wissenschaftlichen Teilprojekten des SFB und dem intensiven Austausch über die individuellen Forschungsprojekte. Eine kurze Einführung in die Papyrologie und die Entstehungsgeschichte der … Was Mumien mit Papyri zu tun haben – Der SFB zu Besuch in Köln weiterlesen
SFB-Retreat zum Auftakt der dritten Förderperiode
Von Ute von Figura am 28. November 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1519
„Die kommenden vier Jahre sollen uns dazu dienen, die Früchte der bisherigen Arbeit zu ernten.“ Mit diesen Worten eröffnete Ludger Lieb, Sprecher des Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“, den diesjährigen SFB-Retreat im Odenwald. Zum Auftakt der dritten Förderperiode des Sonderforschungsbereichs tagten seine Mitglieder vom 21. bis zum 23. November im Seminarzentrum der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach. Auf dem Programm standen das gegenseitige Kennenlernen und Zusammenwachsen sowie die Ausgestaltung der zukünftigen Arbeit in den Themenfeldern des SFB. „Exposition und Durcharbeitung – mit diesen Begriffen lässt sich die Arbeit … SFB-Retreat zum Auftakt der dritten Förderperiode weiterlesen
MATERIALITÄT UND PRÄSENZ SPÄTANTIKER INSCHRIFTEN – NEUER BAND IN MTK-REIHE ERSCHIENEN

Von Ute von Figura am 20. November 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1500
Eine der jüngeren Erkenntnisse der antiken Epigraphik besteht darin, dass Inschriften nicht nur Texte, sondern zugleich materielle Objekte sind, die ihre Wirkung durch ihre Materialität und Präsenz entfalten. Diese Einsicht hat zu vielen Einzelstudien geführt, die bestimmte Inschriftengruppen oder -räume fokussieren – sie wurde bislang aber nicht systematisch auf eine größere Region und eine gesamte Epoche angewendet. In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg ist nun ein neuer Band erschienen, der diese Lücke füllen will. Die Monographie mit dem … MATERIALITÄT UND PRÄSENZ SPÄTANTIKER INSCHRIFTEN – NEUER BAND IN MTK-REIHE ERSCHIENEN weiterlesen
ZWEI NEUE BÄNDE IN MTK-REIHE ERSCHIENEN

Von Ute von Figura am 23. Oktober 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1455
In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg sind zwei neue Bände erschienen. Der englischsprachige Band „Writing Beyond Pen and Parchment – Inscribed Objects in Medieval European Literature“ (Band Nr. 30 der MTK-Reihe) gibt einen vergleichenden Überblick über texttragende Artefakte in mittelalterlichen Literaturtraditionen und zeichnet die Wege der beschrifteten Objekte in den verschiedenen sprachlichen und kulturellen Traditionen nach. Band Nr. 27 mit dem Titel „Antike Texte und ihre Materialität – Alltägliche Präsenz, mediale Semantik, literarische Reflexion“ vereint sechzehn Beiträge verschiedener … ZWEI NEUE BÄNDE IN MTK-REIHE ERSCHIENEN weiterlesen
AUSGEZEICHNETE DISSERTATION – AUGUST-GRISEBACH-PREIS geht an SFB-Wissenschaftlerin

Von Ute von Figura am 22. Oktober 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1434
Für ihre Dissertation „Ikonographie in Bewegung. Überlieferungsgeschichte der Bilder des Welschen Gastes“ ist die SFB-Wissenschaftlerin Lisa Horstmann mit dem August-Grisebach-Preis des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg ausgezeichnet worden. „Der Preis ist für mich Anerkennung der Arbeit der letzten Jahre und Motivation für die anstehende Publikation zugleich. Es ist ein wirklich schöner Abschluss meiner Zeit im Teilprojekt B06“ freut sich die seit 2015 am SFB tätige Wissenschaftlerin über die Ehrung. Die Preisverleihung fand am Montag, den 14. Oktober 2019, in der Neuen Universität … AUSGEZEICHNETE DISSERTATION – AUGUST-GRISEBACH-PREIS geht an SFB-Wissenschaftlerin weiterlesen
Siege, Hochzeiten, neue Kaiser – Susanne Börner untersucht das ‚Massenmedium‘ Münze

Von Ute von Figura am 30. September 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1416
Münzen sind Zahlungsmittel und für manchen Sammler ein wichtiges Kunstobjekt. Im Alten Rom aber war ihre Bedeutung noch eine ganz andere: Als einziges Nachrichten- und Propagandamittel, das im gesamten Reich zirkulierte, sicherten sie Herrschaftsansprüche, informierten über politische Veränderungen und repräsentierten den Kaiser und seine Familie. In abgelegenen Regionen erfuhren die Bürger womöglich erst über eine neue Münzprägung von Machtwechsel, Eheschließungen, Tod oder Geburt im kaiserlichen Haus. Susanne Börner, Wissenschaftlerin am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“, ist fasziniert von den geschichtsträchtigen Zahlungsmitteln und weiß viele Geschichten zu … Siege, Hochzeiten, neue Kaiser – Susanne Börner untersucht das ‚Massenmedium‘ Münze weiterlesen
MASORA UND EXEGESE – SFB GIBT NEUEN BAND IN MTK-REIHE HERAUS

Von Ute von Figura am 25. September 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1409
Der mittelalterliche Kommentar des Raschi (R. Schlomo ben Yitzchaq, Troyes 1040–1105) gehört zum Kernbestand des jüdischen Schriftwesens. Bis heute wird der Raschi-Kommentar in den jüdischen Druckausgaben der hebräischen Bibel an der Seite des hebräischen Obertextes abgedruckt und stets zur Lesung des Wochenabschnitts rezipiert. In der Reihe „Materiale Textkulturen“ des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der Universität Heidelberg ist nun ein neuer Band erschienen, der anhand ausgewählter Stellen die Zitationen der hebräischen Bibel und der Masora in den frühesten Rezensionen des Raschi-Kommentars untersucht. Autor des 24. MTK-Bands … MASORA UND EXEGESE – SFB GIBT NEUEN BAND IN MTK-REIHE HERAUS weiterlesen
Funerary Landscapes of the Late Antique Oecumene – conference report

Von Ute von Figura am 26. August 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1391
by Stefan Ardeleanu and Jon C. Cubas Díaz (first published on www.hsozkult.de) Although funerary contexts represent a major proportion of the entire material evidence from Late Antiquity, until today no comparative pan-Mediterranean panorama exists on this central topic of Late Antique everyday life. Therefore an international conference organized by researchers at Heidelberg University’s Collaborative Research Centre 933 “Material Text Cultures“ united 30 specialists for Late Antique funerary habits. The first focus was given to questions on how funerary inscriptions were incorporated in mortuary practices, … Funerary Landscapes of the Late Antique Oecumene – conference report weiterlesen
Der Forscher als Kommunikator – ein Interview mit Christian Vater

Von Ute von Figura am 19. August 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1370
Der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ untersucht Geschriebenes in non-typographischen Gesellschaften – solchen Gesellschaften also, in denen es noch keine massenhafte Vervielfältigung von Schrift gab. Wie kommt es aber, dass sich eines seiner Projekte der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit den Neuen Medien verschrieben hat? Christian Vater, wissenschaftlicher Mitarbeiter am SFB, erklärt, was es hiermit auf sich hat. Ute von Figura: Christian, du hast die vergangenen vier Jahre in dem Projekt Ö „Schrifttragende Artefakte in Neuen Medien“ gearbeitet. Was ist die Idee hinter diesem Projekt? Christian … Der Forscher als Kommunikator – ein Interview mit Christian Vater weiterlesen
SFB beim International Medieval Congress vertreten – Austausch zum Thema „Materialities“

Von Ute von Figura am 25. Juli 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1351
Ein Bericht von Paul Schweitzer-Martin Vom 1. bis 4. Juli 2019 besuchten acht Mitglieder des Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“ den International Medieval Congress (IMC) in Leeds. Der Themenschwerpunkt des diesjährigen IMC lautete „Materialities“. In insgesamt fünf Vortragspanel sprachen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFBs über ihre Forschung auf diesem Gebiet. Der IMC, der zum 26. Mal stattfand, wird vom „Institute for Medieval Studies“ der University of Leeds organisiert. Mit über 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt handelt es sich um eine der größten Fachtagungen … SFB beim International Medieval Congress vertreten – Austausch zum Thema „Materialities“ weiterlesen
Mit Liebe fürs Detail – Melanie Trede untersucht handschriftliche und gedruckte Artefakte aus Japan

Von Ute von Figura am 2. Juli 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1328
Die besondere Textur einer Teeschale, die Ästhetik einer kalligraphischen Handschrift – in der japanischen Kultur spielen die Wertschätzung für die Materialität von Dingen und der künstlerische Umgang mit Schrift eine zentrale Rolle. Melanie Trede lernte beide Aspekte bei zahlreichen Aufenthalten in Japan kennen und schätzen. Seit fünfzehn Jahren ist sie Professorin am Institut für Kunstgeschichte Ostasiens in Heidelberg. Am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ der Universität leitet sie das neue Teilprojekt B14 „Interaktive Materialitäten: Interdependenzen zwischen Geschriebenem/Gemaltem und Gedrucktem im Japan des 17. Jahrhunderts“. Ute von … Mit Liebe fürs Detail – Melanie Trede untersucht handschriftliche und gedruckte Artefakte aus Japan weiterlesen
Der SFB im Fernsehen
Von Ute von Figura am 1. Juli 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1341
Was hat es mit der Erforschung von schrifttragenden Artefakten auf sich? In der Sendung „Campus TV“ vom 27. Juni 2019 stellt das Rhein-Neckar-Fernsehen den Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ vor. Hierzu war ein Fernsehteam zwei Tage lang für Filmaufnahmen in Heidelberg und interviewte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFBs.
Manuscript in Print – The Written and the Painted in Early Modern Japanese Publishing Culture

Von Ute von Figura am 19. Juni 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1317
A workshop on the early modern Japanese publishing culture is held from 27th to the 28th of June at the Collaborative Research Centre “Material Text Cultures”, Heidelberg University. The workshop aims to amalgamate insights and approaches to the dynamic processes of handwritten/painted artefacts and the emerging printed production in 17th Century Japan. The study of Japanese publishing cultures in early-modern urban centres is currently transforming based on two interrelated developments. On the one hand, the investigation of artistic production is diversifying across a spectrum … Manuscript in Print – The Written and the Painted in Early Modern Japanese Publishing Culture weiterlesen
Diagramme in musiktheoretischen Handschriften – Charakteristika und Entwicklung

Von Ute von Figura am 3. Juni 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1309
Ein Tagungsbericht von Naomi Nordblom und Till Stehr „Eine Diagrammatologie für Musiktheorie zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Konzepte, Verschriftlichungen und Texttraditionen“ – zu diesem Thema haben Wissenschaftler des Heidelberger Sonderforschungsbereichs „Materiale Textkulturen“ im vergangenen Dezember einen Workshop veranstaltet. Ziel war es, mögliche Verbindungen zwischen der Forschungsrichtung der Diagrammatologie und einer Materialitätsperspektive zu diskutieren. So waren neben musikwissenschaftlichen auch historische und philosophische Beiträge präsent. Organisiert wurde die zweitägige Veranstaltung von Dr. Eva Maschke und Hein Sauer, wissenschaftliche Mitarbeiter im Teilprojekt B11 des SFB, das sich … Diagramme in musiktheoretischen Handschriften – Charakteristika und Entwicklung weiterlesen
Self-Fashioning – Sylvia Brockstieger untersucht autobiographische Zeugnisse der Frühen Neuzeit

Von Ute von Figura am 28. Mai 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1295
„Der Prozess der Identitätsbildung und der öffentlichen Person nach einem Satz von sozial akzeptablen Standards“ – so lautet eine Definition des Begriffs Self-Fashioning. Ohne Frage: Mit Einzug der sozialen Medien hat dieses Phänomen ganz neue Blüten getrieben. Doch ist Self-Fashioning keineswegs dem Internet-Zeitalter vorbehalten. Wie konstruierten Menschen im 16. und 17. Jahrhundert – einer Zeit des medialen Umbruchs von der Hand- zur Druckschriftlichkeit – ihre Identität und stellten diese dar? Gibt es Parallelen zu aktuellen Selbstdarstellungsformen? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich die … Self-Fashioning – Sylvia Brockstieger untersucht autobiographische Zeugnisse der Frühen Neuzeit weiterlesen
Grund zu feiern – SFB „Materiale Textkulturen“ geht in die dritte Runde

Von Ute von Figura am 23. Mai 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1276
„Wir sind dankbar für den Vertrauensbeweis durch die DFG und freuen uns, dass wir unsere inspirierende und erfolgreiche Forschung in den kommenden vier Jahren fortsetzen dürfen“, so der SFB-Sprecher Prof. Dr. Ludger Lieb. Zum dritten Mal wird der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ für eine Periode von vier Jahren durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. Damit erreicht der einzige geisteswissenschaftliche SFB an der Universität Heidelberg die maximale Förderdauer von zwölf Jahren. Die Fördergelder für die kommende Periode betragen rund 9,4 Millionen Euro. Im Mittelpunkt des Sonderforschungsbereichs 933 … Grund zu feiern – SFB „Materiale Textkulturen“ geht in die dritte Runde weiterlesen
Moderne Black Boxes – Workshop zu komplexen digitalen Artefakten

Von Ute von Figura am 22. Mai 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1256
Mit dem Versiegeln und Öffnen sogenannter Black Boxes beschäftigt sich ein Workshop, der vom 23. bis 25. Mai am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ der Universität Heidelberg stattfindet. Im Fokus der Veranstaltung stehen komplexe technische Gegenstände, die in unserem Alltag gleichzeitig wirken und verschwinden. Beispiele für derartige ‚Black Boxes‘ sind Smartphones, ‚Künstliche Intelligenz‘ oder großräumige Kommunikations- oder Sensornetzwerke. Ein tiefergehendes Verständnis für dieses Phänomen moderner Black Boxes zu schaffen, ist Ziel des Workshops. „Es gibt zunehmend Dinge, die wir nutzen, die für uns aber im Grunde … Moderne Black Boxes – Workshop zu komplexen digitalen Artefakten weiterlesen
How to bury somebody – Conference on Late Antique funerary research

Von Ute von Figura am 14. Mai 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1235
Funerary practices and epitaphs are key factors in the understanding of cultural transformation processes. Late Antiquity was doubtlessly one of such transitional phases. Still, the knowledge of burial habits of this period is very uneven. Researchers at Heidelberg University’s Collaborative Research Centre 933 “Material Text Cultures” have organized a conference to draw a more complete picture of sepulchral habits and to give a Mediterranean-wide overview of Late Antique funerary landscapes. The event with the title “Funerary Landscapes of the Late Antique oecumene – Contextualizing … How to bury somebody – Conference on Late Antique funerary research weiterlesen
BLOSSE SPIELEREI ODER NÜTZLICHES WERKZEUG? FORSCHER DISKUTIEREN DEN WERT VON NETZWERKANALYSEN

Von Ute von Figura am 8. Mai 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1211
Wieso ist die Netzwerkanalyse in den historischen Geisteswissenschaften beständiger Kritik ausgesetzt? Aus welchen Gründen ist es für Forscherinnen und Forscher dieser Disziplinen so schwierig, sich mit der computergestützten Methode anzufreunden? Derlei Fragen um den Wert der Netzwerkanalyse standen im Zentrum der Tagung „Visualisierung als Provokation? Netzwerkanalysen in Mediävistik und Altertumswissenschaften“, die Anfang April im Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg stattfand. Hierzu eingeladen hatte der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ gemeinsam mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. „Als Methode der quantitativen und visuellen Forschung haben Netzwerkanalysen einen … BLOSSE SPIELEREI ODER NÜTZLICHES WERKZEUG? FORSCHER DISKUTIEREN DEN WERT VON NETZWERKANALYSEN weiterlesen
Verborgene Bedeutungen – Sarina Tschachtli erforscht Kulturen anhand ihrer literarischen Zeugnisse

Von Ute von Figura am 30. April 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1184
Bücherlesen als Ausbildung? Die Studienfachwahl fiel Sarina Tschachtli leicht: Deutsche und Englische Sprach- und Literaturwissenschaft sollte es sein. Die Faszination für das Geschriebene treibt die 33-Jährige bis heute an. Für sie wird es spannend, wo es für Freizeitleser aufhört: Wenn es an das Zerlegen eines Textes geht, die Suche nach verborgenen Bedeutungen, den Rückschlüssen, die ein Text über die Kultur zulässt, aus der er stammt. Seit Februar dieses Jahres ist Sarina Tschachtli Juniorprofessorin für Germanistische Mediävistik an der Universität Heidelberg. Am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ … Verborgene Bedeutungen – Sarina Tschachtli erforscht Kulturen anhand ihrer literarischen Zeugnisse weiterlesen
Schrift am Grab als Fenster zu lang vergangenen Welten
Von Ute von Figura am 24. April 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1177
Wie eine Gesellschaft mit ihren Toten umgeht, verrät viel über die Gesellschaft an sich. Grabinschriften aus lang vergangenen Kulturen und die sozialen Praktiken, in die sie eingebunden waren, stellen somit ein Fenster zum Verständnis dieser Kulturen dar. Stefan Ardeleanu und Jon Cosme Cubas Díaz vom Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ berichten in der Serie „3-Minuten-Wissenschaft“ über ihre Forschung zu Grabinschriften und Bestattungsbräuchen. Sie zeigen auf, wie wichtig es ist, die Inschriften nicht losgelöst von architektonischen, kunsthistorischen und rituellen Aspekten der Gräberkultur in den Blick zu … Schrift am Grab als Fenster zu lang vergangenen Welten weiterlesen
In Zeiten des Umbruchs – Workshop zum Übergang von der Handschriften- zur Druckkultur

Von Ute von Figura am 17. April 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1146
Die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert stellt eine zentrale Epoche der materialen Textkultur dar: den Übergang von der Handschriften- zur Druckkultur. Ende April treffen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ der Universität Heidelberg, um diese ereignisreiche Zeit näher zu beleuchten. Der zweitägige Workshop mit dem Titel „Cultures du texte, cultures du livre“ findet am 25. und 26. April im Historischen Seminar der Universität statt. „Der Übergang von der Handschriften- zur Druckkultur bedeutete mehr als den bloßen Wechsel eines Mediums“, … In Zeiten des Umbruchs – Workshop zum Übergang von der Handschriften- zur Druckkultur weiterlesen
Arbeitspatz Wissenschaft
Von Ute von Figura am 15. April 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1032
Wie arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Sonderforschungsbereich “Materiale Textkulturen”? Wie sehen ihre Arbeitsplätze aus, wie denken sie über die Objekte, die sie untersuchen – und warum haben sie sich für die Wissenschaft als Beruf entschieden? Unter dem Titel “Arbeitsplatz Wissenschaft” stellt der SFB seine Mitglieder vor. Um die Slideshow auf voller Browser-Größe zu sehen, klicken Sie hier
Zeitreise in das antike Denken – Anna Sitz erforscht vergangene Welten

Von Ute von Figura am 27. März 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/975
Wie dachten die Menschen vor 2.000 Jahren? Was bewegte sie? Waren sie sich der Vergangenheit bewusst, wenn sie in Kontakt mit Zeugnissen aus noch früheren Zeiten kamen? Anna Sitz versetzt sich gerne in die Köpfe von Menschen aus lang vergangenen Epochen. Ihre Forschung an schrifttragenden Gegenständen aus hellenistischen und römischen Zeiten hilft ihr dabei, eine Verbindung mit der antiken Denke aufzubauen. Seit September 2018 arbeitet die 30-Jährige am SFB „Materiale Textkulturen“ – und soll hier im Sommer die Leitung des Unterprojekts „Die Präsenz von Inschriften in griechischen Heiligtümern: Die Evozierung der polis in epigraphischen Inszenierungen“ übernehmen. Im Gespräch erklärt sie, was sie an ihrer Forschung so fasziniert.
Von Eulen und Konsonanten – Besuch im Ägyptologischen Institut Heidelberg

Von Nele Schneidereit am 31. Januar 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/926
Die Veranstaltungsreihe „Heidelberger Schriftstücke“ kommt am 13. Dezember 2018 zu ihrem Ende, das sie mit einer weiteren exklusiven Führung durch eine sonst nicht geöffnete Sammlung beschließt: Prof. Joachim Friedrich Quack, Direktor des Ägyptologischen Instituts, präsentiert der kleinen Runde in unmittelbarer Nähe bedeutende Objekte des ägyptischen Schriftsystems. Sein Gang durch die Sammlung führt ein in eine für die „Heidelberger Schriftstücke“ bisher unbekannte Welt der Verknüpfung von Schrift und Bild auf Artefakten in einer Sprache, von der heute niemand sicher sagen kann, wie sie gesprochen klingt. Von Christiane Schröter
Wiege der Schrift – Die Uruk-Warka-Sammlung

Von Nele Schneidereit am 31. Januar 2019
Link: https://sfb933.hypotheses.org/919
Am 8. November 2018 zeigen Prof. Dr. Kai Lämmerhirt, Leiter der Uruk-Warka-Sammlung, und deren Kuratorin Kristina Sieckmeyer eine Auswahl der ältesten mesopotamischen Schriftstücke; es sind zugleich die ältesten Stücke, die im Rahmen der „Heidelberger Schriftstücke“ präsentiert werden. Etwa ab dem Jahreswechsel zu 2020 werden sie in einer Ausstellung zu sehen sein, zu der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reihe Heidelberger Schriftstücke einen Vorgeschmack erhalten. Von Christiane Schröter Die Uruk-Warka-Sammlung befindet sich im zweiten Stock des unscheinbaren Gebäudes in der Marstallstraße 6, in dem auch … Wiege der Schrift – Die Uruk-Warka-Sammlung weiterlesen
Nodes, edges and diagrams. A report on work in progress from the “networks” working group

Von Nele Schneidereit am 15. November 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/782
Von Rodney Ast, Clementina Caputo, Jana Pacyna und Michael R. Ott I. Introduction About three years ago the CRC’s working group 7 started to analyze one of the most formative metaphors of the early 21st century: networks. First, we concentrated at a more theoretical level on “Actor-Network-Theory” (ANT), most often associated with French sociologist and philosopher Bruno Latour, before turning to SNA, “Social Networks Analysis. This methodology has gained momentum for quite some time in social sciences and humanities. SNA is a powerful tool to … Nodes, edges and diagrams. A report on work in progress from the “networks” working group weiterlesen
Götter und Moneten – Antike Numismatik in Heidelberg

Von Nele Schneidereit am 2. November 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/704
Dr. Susanne Börner, Leiterin des Heidelberger Zentrums für antike Numismatik, das rund 5.000 numismatische Objekte zu seinen Schätzen zählt, und zwei ihrer Studenten führen durch die kleine Ausstellung „Die Götterwelt der Antike“, die zurzeit in der Zweigstelle der Universitätsbibliothek im Neuenheimer Feld zu sehen ist. Am Ende der Veranstaltung wird sogar eine Münze aus dem Römischen Reich durch die Hände der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen. Von Christiane Schröter und Nele Schneidereit Die „Heidelberger Schriftstücke“ ziehen diesen Monat wieder weitere Kreise: Es geht raus aus … Götter und Moneten – Antike Numismatik in Heidelberg weiterlesen
Anstalt und Ornament – Ein Besuch in der Sammlung Prinzhorn

Von Nele Schneidereit am 3. Oktober 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/650
Am Donnerstag, 13. September 2018 stellen der Sammlungsleiter Thomas Röske und der Literaturwissenschaftler Ludger Lieb fünf Archivstücke der Heidelberger Sammlung Prinzhorn vor. Rund fünfzehn schriftinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen mit der Nasenspitze an die Exponate herangehen. Von Dr. Nele Schneidereit Archiv und Ausstellungsräume der Sammlung Prinzhorn liegen in einem Anbau des alten Klinikgebäudes in der Voßstraße. Die Eingangstür in der Mitte des langen Ganges im Erdgeschoss ist geschlossen. Ein Zettel informiert darüber, dass die Sammlung ihre nächste Ausstellung vorbereitet und erst am 10. Oktober … Anstalt und Ornament – Ein Besuch in der Sammlung Prinzhorn weiterlesen
Schrift im Stadtbild

Von Nele Schneidereit am 31. August 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/561
Am 9. August 2018 hält die Reihe „Heidelberger Schriftstücke“ eine Besonderheit bereit: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben den Testlaufs für eine App, mit der man sich bei einem Spaziergang durch Heidelberg Forschung zu Materialität und Präsenz von Schrift erklären lassen kann. Die Soziologin Friederike Elias und ihre beiden Kolleginnen Jana Richter und Ria Würdemann wollen an Schrift im Stadtbild den Titel des Sonderforschungsbereiches 933 verständlich machen: „Materiale Textkulturen – Materialität und Präsenz des Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften“. von Nele Schneidereit und Christiane Schröter
Lobdengau-Museum: Götterkult und Wegweiser im römischen Germanien

Von Nele Schneidereit am 27. Juli 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/508
Am Donnerstag, den 12. Juli, machte die Reihe „Heidelberger Schriftstücken“ einen Ausflug nach Ladenburg. Im Lobdengau-Museum entziffern Museumsleiter Andreas Hensen und Althistoriker Christian Witschel römische Inschriften auf Stein aus einer der ältesten Städte Deutschlands. Die Erforschung von Inschriften (Epigraphik) gibt Aufschluss über lange vergangene politische, religiöse und kulturelle Strukturen. Von Christiane Schröter Treffpunkt Vorplatz des Lobdengau-Museums in Ladenburg – es ist ein besonders heißer Tag im Juli. Nach einer Reise vorbei am Neckar und in die pittoreske Altstadt Ladenburgs steigen die Teilnehmer der Veranstaltung … Lobdengau-Museum: Götterkult und Wegweiser im römischen Germanien weiterlesen
„Mit Freude schenke ich nach“ – Ein Besuch im Antikenmuseum

Von Nele Schneidereit am 28. Juni 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/482
Der sechste Besuch der Reihe “Heidelberger Schriftstücke” gilt dem Antikenmuseum der Universität Heidelberg. Gut gelaunt zeigt uns Nikolaus Dietrich, Juniorprofessor für Klassische Archäologie, jahrtausendealte Trinkgefäße mit Bild und Schrift. Von Christiane Schröter und Nele Schneidereit Im Marstallhof sitzt man gemütlich – es wird das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft 2018 übertragen. Pünktlich zum Anstoß betreten die Besucherinnen und Besucher der Reihe Heidelberger Schriftstücke jedoch das Zentrum für Altertumswissenschaften und gehen die vier Stockwerke nach oben in das Antikenmuseum. Mit jedem Stockwerk wird es wärmer. Schließlich gelangen wir … „Mit Freude schenke ich nach“ – Ein Besuch im Antikenmuseum weiterlesen
Papyri – Steuerquittungen, Kaufverträge, Briefe und ein Stück Bibel

Von Nele Schneidereit am 16. Juni 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/468
Auch am 17. Mai 2018 kommen die Besucher der „Heidelberger Schriftstücke“ in den Genuss einer eigens für sie zusammengestellten Objektauswahl. Andrea Jördens, Professorin für Papyrologie, hat die Tür zur Bibliothek des Instituts für Papyrologie und damit zur zweitgrößten Papyrussammlung in Deutschland geöffnet. Von Christiane Schröter und Nele Schneidereit Eine lange Tischreihe. Das Licht spiegelt sich auf den Schutzhüllen der zum Teil gerade einmal handtellergroßen Schriftstücke aus Papyrus. Schon der erste Blick zeigt, dass die Besucher etwas dürfen, was Museen und Sammlungen fast nie erlauben … Papyri – Steuerquittungen, Kaufverträge, Briefe und ein Stück Bibel weiterlesen
Karzer-Kritzeleien

Von Nele Schneidereit am 30. April 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/454
Die Reihe „Heidelberger Schriftstücke“ hat im April einen großen Schritt in die Neuzeit gemacht: Der Studentenkarzer in der Augustinergasse ist berühmt für die Schriften und Bilder an seinen Wänden. Sie sind um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden. Durch die engen Räume führte die Archäologin und Epigraphikerin Ulrike Ehmig, die am Sonderforschungsbereich ‚Materiale Textkulturen‘ antike Fluchtafeln erforscht. Im Karzer trafen daher Vormoderne und Neuzeit zusammen. Von Christian Schröter und Nele Schneidereit In einem kleinen Hinterhof befindet sich linkerhand eine offene Tür zu … Karzer-Kritzeleien weiterlesen
Der mittelhochdeutsche Knigge auf Pergament und in Bits

Von Nele Schneidereit am 27. März 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/443
Im holzvertäfelten Rundzimmer der Universitätsbibliothek präsentieren die stellvertretende Leiterin der Historischen Sammlung, Karin Zimmermann, und die Kunsthistorikerin Lisa Horstmann vier mittelalterliche Handschriften des Welschen Gast von Thomasin von Zerklaere. Nebenher geben sie auch noch eine Einführung in die Digitalisierung von Manuskripten. Von Christiane Schröter und Nele Schneidereit Letzte Reste der Abendsonne fallen auf den großen runden Tisch. Darauf liegen vier Buchwiegen aus grauem Schaumstoff mit aufgeschlagenen Handschriften aus dem Mittelalter. An einer Seite hat Karin Zimmermann eine Heftlade aus Holz aufgebaut; ein hohes, schmales … Der mittelhochdeutsche Knigge auf Pergament und in Bits weiterlesen
Ein Hort für Schriftkultur

Von Nele Schneidereit am 28. Februar 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/424
Die „Heidelberger Schriftstücke“ wechselten am 8. Februar ihre Szene; im Januar ging es durch dicke Tresortüren in den Keller, nun in die Bel Etage mit Parkett, Stuck und Kerzenlüstern. Wir sind zu Besuch im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg. Museumsdirektor Frieder Hepp und Restauratorin Yvonne Stoldt zeigen Objekte aus dem graphischen Kabinett. Auf dem Weg zum Großen Salon des Museums muss man sich ermahnen, den Beginn der Veranstaltung nicht dadurch zu verpassen, dass die Augen an einem der beeindruckenden Exponate hängen bleiben, die den … Ein Hort für Schriftkultur weiterlesen
Das Gedächtnis der Universität

Von Nele Schneidereit am 23. Januar 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/403
Am 11. Januar hatte die Veranstaltungsreihe „Heidelberger Schriftstücke“ ihren Auftakt im Universitätsarchiv. Der Leiter des Archivs, Ingo Runde, eröffnete die Stunde im Archiv mit Zahlen und Ereignissen aus dessen Geschichte. Seine Kollegin Heike Hawicks präsentierte Ergebnisse einer Studie des Archivs zur Verwendung von Papier und Pergament im ausgehenden Mittelalter. Im Anschluss zeigte Herr Runde ausgewählte Dokumente des Archivs. von Nele Schneidereit und Christiane Schröter Eine schlichte Wendeltreppe im hinteren Bereich des Vortragsraumes führt in das Untergeschoss des Heidelberger Universitätsarchivs. Unten angekommen, kann man die … Das Gedächtnis der Universität weiterlesen
Prachtvolle Manuskripte, unsichtbare Tintenflecke, legendäre Raben – Eine Reise nach Mitteldeutschland

Von Nele Schneidereit am 18. Januar 2018
Link: https://sfb933.hypotheses.org/380
Eine Gruppe von 25 Heidelberger Studierenden und Dozenten erkundete im Rahmen der interdisziplinären Exkursion „Mittelalterliche Handschriften, Schätze, Dome und Burgen“ vom 23. bis zum 26. Juni 2017 Bibliotheken und Kulturdenkmäler in Leipzig, Erfurt, Naumburg, Merseburg, Gotha und Eisenach. Die Gruppe setzte sich aus den Bereichen der Heidelberger Fächer Germanistik, Kunstgeschichte und Mittellatein zusammen. Die Exkursion wurde von Ludger Lieb (Germanistische Mediävistik), Tobias Frese (Mittelalterliche Kunstgeschichte) und Tino Licht (Mittellatein) geleitet. Gastbeitrag von Katharina Gruenke und Stefan Bröhl Im Vordergrund der Exkursion stand die direkte … Prachtvolle Manuskripte, unsichtbare Tintenflecke, legendäre Raben – Eine Reise nach Mitteldeutschland weiterlesen
Wissenschaft und Wikipedia

Von Nele Schneidereit am 14. Dezember 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/363
Der Heidelberger Altgermanist Professor Ludger Lieb über Potenziale und Grenzen der Wikipedia für die Geisteswissenschaften Vom 10. bis 11. November 2017 fand in der Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Heidelberg eine Schreibwerkstatt der Wikimedia Deutschland e.V. Initiative Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAM on tour) statt. In Kooperation mit der UB Heidelberg und dem SFB 933 trafen sich Wikipedianerinnen und Wikipedianer mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der UB und der Uni Heidelberg. Gemeinsam arbeiteten sie daran, wie das Wissen der berühmten Handschriftenabteilung der UB Heidelberg in die … Wissenschaft und Wikipedia weiterlesen
Heidelberger Schriftstücke
Von Nele Schneidereit am 14. Dezember 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/358
Im Jahr 2018 veranstaltet der SFB 933 gemeinsam mit dem Heidelberg Centre for Cultural Heritage (HCCH) zwölf ‘Objektbegegnungen’ mit Schriftstücken, die sich in Heidelberg und Umgebung befinden. Die Termine finden jeden zweiten Donnerstag im Monat statt. Schrift. Schrift. SCHRIFT ist überall. Unser Alltag ist ohne Schrift nicht vorstellbar. Sie begegnet uns auf Verkehrsschildern, beim Bäcker, auf der Zuckerdose, in SMS, in Briefen, in Büchern, auf Hauswänden, auf dem kleinen Zettelchen im Pullover … Es gibt fast kein hergestelltes Ding ohne Schrift, viele Dinge gäbe … Heidelberger Schriftstücke weiterlesen
Juniorprofessur/ Teilprojektleitung
Von Nele Schneidereit am 8. November 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/342
Juniorprofessur (W1 voraussichtlich ohne Tenure Track) für Germanistische Mediävistik mit Option auf Teilprojektleitung im SFB 933 An der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg ist oben genannte Stelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt – bei Erfüllung der allgemeinen beamten- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen – im Beamtenverhältnis auf Zeit, zunächst für vier Jahre. Eine Verlängerung um weitere zwei Jahre ist nach positiver Evaluation vorgesehen. Die neu geschaffene Juniorprofessur soll die am Ort vorhandene germanistisch-mediävistische Forschung und Lehre (in den Bachelor- und Master-Studiengängen) verstärken sowie aktiv am Sonderforschungsbereich … Juniorprofessur/ Teilprojektleitung weiterlesen
Eine Frage der Form

Von Nele Schneidereit am 3. November 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/333
Bericht über die Tagung „The Roll in Western Europe in the Late Middle Ages“, Universität Heidelberg, SFB 933 „Materiale Textkulturen“, TP B10 „Rollen im Dienst des Königs“, 28.–29. September 2017 Gastbeitrag von Stefan Holz (TP B10 “Rollen im Dienst des Königs”) Im Zentrum der international besetzten Tagung The Roll in Western Europe in the Late Middle Ages, die vom Teilprojekt B10 Rollen im Dienst des Königs des Heidelberger SFBs 933 Materiale Textkulturen organisiert wurde, standen die Materialität und Praxeologie spätmittelalterlicher Schriftrollen in Westeuropa, vor … Eine Frage der Form weiterlesen
Kalligraphische Korantafeln
Von Nele Schneidereit am 26. Juli 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/322
Anastasia Grib erforscht eine uralte Schrifttradition des islamischen Afrika. Sie war als Stipendiatin im Jahr 2013 am SFB 933. Im Mai 2017 kehrte sie für einen Monat als Fellow des Alumni International-Programms der Universität Heidelberg zurück. Anastasia Grib erforscht kalligraphische Korantafeln. Die Disziplin, die sie dazu befähigt, lässt sich nicht leicht angeben. Sie ist Kunsthistorikerin, Islamwissenschaftlerin und Anthropologin. Derzeit arbeitet sie als Redakteurin für einen Guide to Islamic Calligraphy an der Eremitage in St. Petersburg. Frau Grib war im Jahr 2013 als Fellow am … Kalligraphische Korantafeln weiterlesen
Praxis-Workshop Marmor. Ein Bericht in Bildern

Von Nele Schneidereit am 19. Juli 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/264
Vom 2. bis 9. April 2017 veranstaltete der SFB 933 gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) Istanbul einen praxisorientierten Workshop zum Thema „Materialität von Marmor als Schriftträger und seine Wiederverwendung als Spolie im städtischen Raum“. Text: Stephan Westphalen In Istanbul sind zahlreiche beschriftete Steinartefakte erhalten. Historiker, Kunsthistoriker, Archäologen und Philologen veranstalteten gemeinsam einen Workshop, bei dem sie mit einem interdisziplinären Ansatz besichtigt wurden. Die Artefakte decken einen über 3000jährigen Zeitraum ab und wirken – früher wie heute – als Schriftträger im städtischen Raum. … Praxis-Workshop Marmor. Ein Bericht in Bildern weiterlesen
Zerknitterte Pergamentstückchen, Palimpseste und Buchumschläge

Von Nele Schneidereit am 3. Juli 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/253
Im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum wurden von März bis Juni 2017 Zeugnisse früher Mainzer Schriftlichkeit ausgestellt. Neben großen Torinschriften und prachtvoll gearbeiteten Bibeln finden sich Blätter und Bücher, die deutliche Spuren unachtsamen Gebrauchs oder nachlässiger Aufbewahrung zeigen. Die Heidelberger Mittellateinerin Kirsten Wallenwein lässt bei ihrer Führung durch die Ausstellung gerade diese – auf den ersten Blick weniger kostbaren – Exponate in hellem Licht erstrahlen. Es war einmal eine Zeit, da war die Stadt Mainz ein Zentrum gelehrter Schriftlichkeit. Im Dom zu Mainz befand sich … Zerknitterte Pergamentstückchen, Palimpseste und Buchumschläge weiterlesen
Wortbilder: Tiere und Pflanzen aus Text

Von Nele Schneidereit am 21. Juni 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/233
Am 10. Juli wird die Ausstellung “GALGAL. Schöpfungselemente in Bewegung” in der Synagoge Worms feierlich eröffnet. Die computeranimierte Inszenierung zeigt ornamental-figurative Mikrographien aus mittelalterlichen jüdischen Bibelhandschriften. Tiere und Pflanzen, aus kleinen Buchstaben zusammengesetzt finden sich an den Seitenrändern einiger Codices der hebräischer Bibel des Mittelalters (Masora). Die kleinen figürlichen Darstellungen stehen im Zentrum der Forschung des Teilprojekts B04 am SFB 933 – und nun auch im Zentrum einer Ausstellung. In der Wormser Synagoge wird am 10. Juli 2017 die multimediale Ausstellung »GALGAL. Schöpfungselemente in … Wortbilder: Tiere und Pflanzen aus Text weiterlesen
Epigraphik griechischer Heiligtümer

Von Nele Schneidereit am 13. Juni 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/202
Am 9. und 10. Mai 2017 fand an der Universität Münster ein Workshop statt, bei dem es um Inschriften in Heiligtümern der griechischen Antike ging. Heiligtümer waren im antiken Griechenland ein beliebter Ort für die Anbringung von Inschriften. Texte unterschiedlichster Gattungen finden sich – offizielle Verlautbarungen, Staatsverträge, Ehr- und Weihinschriften. Besucher müssen damals von der schieren Menge und Allgegenwart der Texte geradezu erschlagen gewesen sein. Der Workshop „Understanding the Epigraphy of Greek Sanctuaries“ hatte das Ziel, die massive Präsenz von Inschriften in … Epigraphik griechischer Heiligtümer weiterlesen
Bodies, Images, Inscriptions.

Von Nele Schneidereit am 9. Juni 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/215
An interview with art historian Michele Luigi Vescovi from the University of Lincoln (UK), who was visiting the CRC 933 in the month of May, 2017. Michele, you are here as a guest researcher for three weeks. How did you get in contact with the CRC 933? I met Wilfried Keil, member of subproject A05 “Script and Characters on and in Medieval Artwork”, at a conference in Bamberg in 2013. Afterwards, I invited him as a speaker in a workshop on the interactions between … Bodies, Images, Inscriptions. weiterlesen
Marmor. Eine Ortsbegehung

Von Nele Schneidereit am 19. Mai 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/195
Denkt man an antike Inschriften, so denkt man an Marmor. Was macht Marmor als Beschreibstoff so besonders? Benjamin Allgaier, Doktorand der Klassischen Philologie (Gräzistik) am SFB 933, fuhr Anfang April 2017 mit Archäologen, Althistorikern und Mittelalter-Kunsthistorikern nach Istanbul und auf die Insel Marmara im gleichnamigen Meer. Im Interview berichtet er über den Praxis-Workshop, der vor antiken Monumenten aus Marmor und im Steinbruch stattfand. Nele Schneidereit: Lieber Benny, wie sah das Konzept Eurer Reise aus und welche Stationen hatte sie? Benjamin Allgaier: Wir waren zuerst … Marmor. Eine Ortsbegehung weiterlesen
GIS mapping of Leptis magna
Von Nele Schneidereit am 17. Mai 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/185
Francesca Bigi, specialist in antique architectural decoration and epigraphy, spent a month at the CRC “Material Text Cultures”. During her time at the CRC, she answered by questions about her work on the digital map of inscriptions found in the remains of the antique city of Leptis magna. (Interview: Sept., 20th 2016) Nele Schneidereit: Dear Francesca, you are visiting researcher for the month of September at the CRC 933 “Material Text Cultures”. Could you please describe what you are working on during your time … GIS mapping of Leptis magna weiterlesen
Schriftgemeinschaften

Von Nele Schneidereit am 10. Mai 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/145
Die Arbeitsgruppe “Vergesellschaftete Schriften” des SFB 933 richtete am 15. und 16. März 2017 am Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg eine Tagung aus. Es ging um die Frage, was es für einen Text heißt, wenn er zusammen mit anderen Texten – anderer Inhalte, Sprachen oder Schriften – auf ein und dasselbe Artefakt geschrieben wurde und was diese Praxis für den Umgang mit dem Artefakt selbst bedeutet. Texte neben Texten sind metaphorisch gesprochen vergesellschaftete Schriften. Was bedeutet Vergesellschaftung hier? In der Soziologie bezeichnet der Begriff die Einbindung … Schriftgemeinschaften weiterlesen
Vortrag: Elementenlehre und Mathematik
Von Nele Schneidereit am 3. Mai 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/180
Die Altgermanistin Dr. Michaela Wiesinger wird am 11. Mai 2017 um 18 Uhr im Handschriftenlesesaal der Universitätsbibliothek Heidelberg einen Vortrag über die Naturphilosophie in Text und Bild im ›Welschen Gast‹ des Thomasin von Zerklaere halten. Der ›Welsche Gast‹ ist ein 15.000 Verse langes Lehrgedicht, das der Norditaliener Thomasin von Zerklaere um das Jahr 1215 in deutscher Sprache verfasste. Literarisch ist es im Vergleich zu den klassischen Versepen des Mittelalters weniger anspruchsvoll, es hat jedoch einen hohen kulturgeschichtlichen Wert, da es einen seltenen Einblick in … Vortrag: Elementenlehre und Mathematik weiterlesen
Altertumswissenschaftler*innen gesucht!
Von Nele Schneidereit am 25. April 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/173
Stellenausschreibung am HCCH. Zwei E-13 Stellen (100% und 50%) für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen. An unserer wunderbaren Kooperationsinstitution, dem Heidelberg Center for Cultural Heritage (HCCH) an der Universität Heidelberg, sind zum 15.6.2017 (bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt) zwei Stellen in den Bereichen Studiengangsaufbau und universitäre Sammlungen ausgeschrieben. Ausschreibung_HCCH
Ausstellung: Der „Welsche Gast“ des Thomasin von Zerklaere
Von Nele Schneidereit am 18. April 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/170
In Kooperation mit dem SFB 933 präsentiert die Universitätsbibliothek Heidelberg vier Handschriften der mittelalterlichen Verhaltens- und Tugendlehre – Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte Die erste umfassende Verhaltens- und Tugendlehre in deutscher Sprache – der „Welsche Gast“ von Thomasin von Zerklaere – steht im Mittelpunkt einer Kabinett-Ausstellung, zu der die Universitätsbibliothek Heidelberg einlädt. Vier mittelalterliche Handschriften dieses Werks, die zwischen 1250 und 1460/70 entstanden sind, werden zu sehen sein. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf den über die Jahrhunderte hinweg erfolgten … Ausstellung: Der „Welsche Gast“ des Thomasin von Zerklaere weiterlesen
Der spätmittelalterliche Codex

Von Nele Schneidereit am 27. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/131
Materialität als Herausforderung Wie fruchtbar ist der material turn für Mittelalterhistoriker? Zwei Heidelberger Mediävisten veranstalteten am 16. und 17. Februar 2017 einen Workshop zum Thema „Materialität als Herausforderung: Der spätmittelalterliche Codex im Fokus der Historischen Grundwissenschaften“. Beim Sortieren der Kopien schneidet das Papier in den Finger. Das P der alten Tastatur klemmt. Die Kugelschreibermine ist beim Notieren der Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter endgültig leer. Beim Schreiben und Lesen kann die Materialität der Dinge eine echte Zumutung sein. Das ist nicht nur heute so. Wie … Der spätmittelalterliche Codex weiterlesen
Gastbeitrag: Graffiti in Antike, Mittelalter und Neuzeit

Von Nele Schneidereit am 24. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/147
Graffiti gelten Vielen als vandalistisches Geschmiere, und auch den historischen Graffiti haftet deshalb ein negatives Image an. Dabei können sie – als Texte und als Artefakte – wertvolle Informationen liefern, die sich aus anderen Quellen so nicht gewinnen lassen. Eine Konferenz an der LMU München (20.-22. April 2017) widmet sich deshalb vergleichend den Graffiti aus Antike, Mittelalter und Neuzeit. Von Dr. Polly Lohmann Mit dem Begriff Graffiti werden ganz verschiedene Arten von Inschriften bezeichnet, die auch moderne Street Art miteinschließen. Geprägt wurde der Terminus … Gastbeitrag: Graffiti in Antike, Mittelalter und Neuzeit weiterlesen
Praxisworkshop zu Marmorinschriften in der Türkei

Von Nele Schneidereit am 21. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/123
Vom 2. bis 9. April 2017 veranstaltet der SFB 933 gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) Istanbul an verschiedenen Orten in der Türkei einen praxisorientierten Workshop zum Thema „Materialität von Marmor als Schriftträger und seiner Wiederverwendung als Spolie imstädtischen Raum“. Viele Teilprojekte des SFB 933 beschäftigen sich mit Inschriften, die in Marmor eingeschrieben wurden. Die an diesen Projekten beteiligten Wissenschaftler wollen verstehen, wie das Material Marmor funktioniert und was die Arbeit mit diesem Material den Handwerkern in Antike und Mittelalter abverlangt hat. Daher … Praxisworkshop zu Marmorinschriften in der Türkei weiterlesen
Standardisierungsstrategien: Digitale Textverarbeitung mit TEI in der Altgermanistik

Von Nele Schneidereit am 21. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/116
TEI ist seit vielen Jahren das Standardformat für digitale Editionen in den Geisteswissenschaften. Dieses Verdienst kommt dem Format wegen seiner großen und flexiblen Ausdrucksmöglichkeiten zu. Wie so oft, hat auch diese Medaille zwei Seiten: Aufgrund der Flexibilität des Formats ist es schwer, Standardisierungen für das Kodieren mit TEI einzuführen. Dieses Problem wurde auf einem Workshop diskutiert, den der SFB 933 und die Universitätsbibliothek (UB) Heidelberg gemeinsam ausrichteten. Vom 16. bis 17. März traf sich eine große Expertenrunde aus dem Bereich der Digital Humanities, um … Standardisierungsstrategien: Digitale Textverarbeitung mit TEI in der Altgermanistik weiterlesen
Materiale Textkulturen digital: Workshop zu TEI-Kodierungsstrategien

Von Nele Schneidereit am 13. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/100
Vom 16. bis 17. März veranstaltet das altgermanistische SFB 933-Teilprojekt B06 “Text-Bild-Edition des Welschen Gastes” einen Workshop zu TEI-Kodierungsstrategien an und in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg. Der Goldstandard des Edierens ist die Historisch-Kritische Ausgabe (HKA). In jahrelanger Arbeit wird ein Text erarbeitet, der alle Textträger und ihre Varianten berücksichtigt. Der Text wird außerdem bewertet und historisch kontextualisiert. Die HKA ist Ergebnis und Grundlage textbasierter Forschung in den Geisteswissenschaften. Auch wenn es Werkausgaben gibt, deren Bände erst in mehreren Jahren alle erschienen sein werden … Materiale Textkulturen digital: Workshop zu TEI-Kodierungsstrategien weiterlesen
Vergesellschaftete Schriften

Von Nele Schneidereit am 8. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/85
Workshop am Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH) vom 15.-16. März 2017 Das Nebeneinander von Geschriebenem auf ein und demselben Artefakt ist ein Phänomen, das sich über Zeiten und Kulturen hinweg beobachten lässt. Das Geschriebene kann dabei unterschiedliche Inhalte haben oder in verschiedenen Schriftarten ausgeführt sein, es kann in abweichenden Sprachen formuliert oder von unterschiedlichen Händen realisiert worden sein. Neben solche ARTEFAKTVERGESELLSCHAFTUNGEN treten KONTEXTVERGESELLSCHAFTUNGEN. Hier definiert eine Reihe gleichartiger schrifttragender Artefakte durch ihren gemeinsamen archäologischen Kontext ein Ensemble, das inhaltlich wie formal dieselben Divergenzen aufweisen kann. … Vergesellschaftete Schriften weiterlesen
Workshop zur Autorität von Materialität im Mittelalter

Von Nele Schneidereit am 7. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/58
Wie entsteht musikalisches Geschichtsbewusstsein? Warum und wie wird Tradition konstruiert und gepflegt? Welche Bedeutung kommt dabei der materialen Beschaffenheit der Quellen zu? Gemeinsam mit dem europäischen Projekt „Sound Memories“ veranstaltete das musikwissenschaftliche Teilprojekt B11 „Materiale Formierungen musiktheoretischer Konzepte“ am 1. und 2. Dezember einen Workshop, auf dem diskutiert wurde, welche Rolle die materiale Gestaltung für die Konstruktion und Ausübung von Autorität im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit spielte. Das Sound Memories-Projekt verbindet Forscherinnen und Forscher in Cambridge, Heidelberg, Prag, Utrecht und Warschau. … Workshop zur Autorität von Materialität im Mittelalter weiterlesen
Schrift und Knochen – Eva Ferro forscht am SFB 933 zu Heiligenkulten im Mittelalter (Interview vom 23.01.2017)

Von Nele Schneidereit am 7. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/26
Nele Schneidereit: Liebe Eva, Du bist seit Oktober Gastwissenschaftlerin am SFB 933. Wie kam es dazu? Eva Ferro: Ich habe auf einer Fachkonferenz einen Vortrag gehalten. Danach haben Tino Licht und Kirsten Wallenwein mich angesprochen. Übrigens, die beiden haben mich dem ehemaligen Heidelberger Lehrstuhlinhaber für Mittellatein, Walter Berschin vorgestellt als „jemand, der zu Heiligenoffizien forscht“. Das sind mittelalterliche Stundengebets-Texte für Heiligenkulte. Herr Berschin fand das sehr lustig, weil er sich auch intensiv damit beschäftigt hat – es gibt aber nur wirklich wenige Menschen, die … Schrift und Knochen – Eva Ferro forscht am SFB 933 zu Heiligenkulten im Mittelalter (Interview vom 23.01.2017) weiterlesen
Materiale Textkulturen
Von Nele Schneidereit am 6. März 2017
Link: https://sfb933.hypotheses.org/1
Der Sonderforschungsbereich 933 “Materiale Textkulturen” forscht an Dingen, die beschrieben sind: Steine, Papyri, Amulette, Grabsteine. Die beteiligten Wissenschaftler untersuchen, in welcher Weise die Materialität des Geschriebenen in seine Bedeutung eingeht. Es werden ausschließlich solche Artefakte untersucht, die aus Gesellschaften entstammen, die nicht über Mittel der massenhaften Vervielfältigung des Geschriebenen verfügten oder verfügen. Das “Materiale Textkulturen”-Blog soll Einblick in die Forschung bieten und zur besseren Vernetzung der Wissenschaftler, besonders aus den beteiligten so genannten ‘kleinen Fächern’ beitragen.Wir berichten über Veranstaltungen, führen Interviews mit beteiligten Wissenschaftlerinnen … Materiale Textkulturen weiterlesen